11. Kapitel--VI: Israel und die Fremden 1911: Die Juden und das Wirtschaftsleben von Werner Sombart: Zweiter Abschnitt - 11. Kapitel: Die Bedeutung der jüdischen Religion für das Wirtschaftsleben
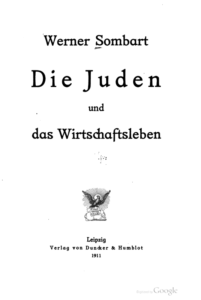
11. Kapitel: Die Bedeutung der jüdischen Religion für das Wirtschaftsleben
VI. Israel und die Fremden
Als wir uns die äußern Umstande ins Gedächtnis riefen, die dem Juden bei seiner wirtschaftlichen Karriere förderlich gewesen sind, mußten wir als ganz besonders wichtigen Faktor die Fremdheit gelten lassen, in der das jüdische Volk alle Jahrhunderte hindurch gelebt hat: die Fremdheit in einem psychologisch-sozialen Sinne gefaßt. Hier gilt es nun festzustellen, daß die Wurzeln dieser Fremdheit in den Satzungen der Religion zu suchen sind, gilt es festzustellen, daß diese selbe Religion zu allen Zeiten die Fremdheit des Juden geschärft und gefestigt hat.
Wir haben die Entwicklung der jüdischen Religion zur Nomokratie verfolgt und eben mit dieser Entwicklung wurde auch naturgemäß die Abschließung des jüdischen Stammes gefördert. „La loi leur donnait l’esprit de clan“, hat Leroy-Beaulieu treffend gesagt, der überhaupt diese Seite der jüdischen Geschichte mit besonderem Glück dargestellt hat. Die bloße Tatsache dieses Gesetzes mußte ja genügen, um seine Anhänger, von allem Verkehr mit ihrer Umgebung auszuschließen. Die Juden mußten abgesondert von den Goim leben, wenn sie ihr Gesetz streng beobachten wollten: sie selbst haben das Getto geschaffen, das ja auch vom nichtjüdischen Standpunkt aus ursprünglich eine Konzession, ein Privilegium, nicht etwa eine Feindseligkeit bedeutete.
Und sie wollten abgesondert leben, weil sie sich erhaben dünkten über das gemeine Volk ihrer Umgebung; weil sie als das auserwählte, das priesterliche Volk sich fühlten. Die Rabbinen haben dann das ihrige getan, um diesen Stolz zu pflegen: Von Esra an, der die Mischehen verbot als eine Entweihung des edlen jüddischen Blutes, bis zum heutigen Tage, da der fromme Jude betet: „Gelobt seist Du, o Herr, daß Du mich nicht zum Goi gemacht hast!„
Und sie haben abgesondert gelebt durch alle die Jahrhunderte hindurch seit der Zerstreuung, trotz der Zerstreuung und (dank eben den festen Banden, in die sie das Gesetz einschloß) wegen der Zerstreuung. Abgesondert und darum zusammengeschlossen oder wenn man lieber will: zusammengeschlossen und darum abgesondert.
Zusammengeschlossen. Das fängt vom babylonischen Exil an, das recht eigentlich den positiven Internationalismus der Juden begründet hat. Viele, namentlich wohlhabende Leute, blieben (wohlgemerkt: freiwillig!) in Babylon zurück, gaben aber ihr Judentum darum nicht auf, sondern behaupteten es mit Eifer. Sie unterhielten einen lebhaften Verkehr mit ihren zurückgewanderten Brüdern, nahmen regen Anteil an ihrem Geschicke, unterstützten sie und sandten ihnen von Zeit zu Zeit neuen Zuzug (484)
Als dann die hellenistische Diaspora sich bildete, wurde der Zusammenhang nicht geringer. „Sie hielten eng zusammen in den einzelnen Städten und in der ganzen Welt. Wo sie sich aufhalten mochten, behielten sie Fuß in Sion. Mitten in der Wüste besaßen sie eine Heimat, in der sie zuhause waren……… Durch die Diaspora traten sie in die Welt ein. In den hellenistischen Städten nahmen sie griechische Art und Sprache an, wenn auch nur als Gewand ihres jüdischen Wesens ……. (Wellhausen).
Und so ist es geblieben durch all die Jahrhunderte hindurch, während welcher die Juden in der Verbannung gelebt haben: eher ist das Band fester geworden, das die gesamte Judenheit umschließt. „Scis quanta concordia“, ruft Cicero (485) aus: Du weißt, wie sie zusammenhalten! Und was aus der römischen Kaiserzeit berichtet wird: bei dem Aufstande des Jahres 130 geriet „die gesamte Judenschaft des In- und Auslandes ….. in Bewegung und unterstützte mehr oder minder offen die Insurgenten am Jordan“ (486), das gilt ja doch wortwörtlich noch heute, wenn irgendwo ein Jude aus einer russischen Stadt ausgewiesen wird.
Zusammengeschlossen und darum abgesondert: ihre fremdenfeindliche Gesinnung, ihre Abschließungstendenz reicht ja weit in das Altertum hinauf. Allen Völkern fiel von jeher ihre „Misoxenie“ auf, die ihnen nachweislich zuerst von Hekataus von Abdera (um 300 v. Chr.) vorgeworfen wird. Wir finden sie dann erwähnt bei vielen Schriftstellern des Altertums (487): immer fast mit denselben Worten. Am bekanntesten ist die Stelle bei Tacitus (H. V. 1 § 5):
„apud es fides obstinata, misericordia in promptu. Sed adversus omnes alios hostille odium. Separati, epulis disereti cubilibus, projectissima ad libidinem gens, alienarum concubitu abstinent.“
Die jüdische Apologetik, die für Juden schrieb, hat diese Anklagen selbst niemals zu widerlegen versucht (488): sie waren also begründet.
Gewiß hielten (und halten) sie so eng zusammen, und schlossen sie sich ab oft auch, weil die Wirtsvölker durch ihre Gesetze und ihr feindseliges Verhalten die Judenschaft von sich fern hielten. Aber ursprünglich und eigentlich doch, weil sie selbst, die Juden, so wollten und so mußten leben nach ihrem Schicksale, das ihre Religion war. Daß dieses der richtige Zusammenhang ist, sehen wir deutlich aus dem Verhalten der Juden dort, wo es ihnen gut erging, wo die Wirtsvölker ihnen zunächst mit aller Sympathie entgegenkamen. Das gilt für manche Zeiten des Altertums, für das ich deshalb absichtlich die Belege für ihre Abschließungstendenz beigebracht habe. Das gilt auch für das Mittelalter. So etwa für Arabien im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Auch dort und damals war das Judentum den arabischen Juden in der Form, wie es überliefert wurde, mit dem Gepräge, das ihnen die Tanaiten und Amorder gegeben hatten, hochheilig. Sie hielten streng die Speisegesetze, die Festtage und den Fasttag der Juden Kippur. Den Sabbat beobachteten sie streng. „Obwohl sie sich in dem gastfreien Lande über nichts zu beklagen hatten, so sehnten sie sich doch nach der Rückkehr ins heilige Land ihrer Väter und erwarteten, jeden Tag die Ankunft des Messias …… Mit den Juden in Palästina standen sie in Verbindung“ usw. (489). Dasselbe Bild, später im maurischen Spanien: Während die Muzaraber, das heißt, die unter den Mohamedanern wohnenden Christen, ihre Eigentümlichkeit an das arabische Wesen soweit aufgaben, daß sie ihrer Muttersprache, das gotische Latein, vergaßen, ihre Bekenntnisschriften nicht mehr verstanden und sich des Christentums schämten, empfanden die Juden Spaniens bei zunehmender Bildung nur noch mehr Vorliebe und Begeisterung für ihre heimatliche Sprache, ihr heiliges Schrifttum und ihre angestammte Religion 399 Das spiegeln auch ihre Denker und Dichter wider: die größten Dichter, die das Judentum im Mittelalter erzeugt, hat — inmitten der spanisch-arabischen Welt, in der sie in langen Zeiträumen geachtet lebten — sind streng „national“, also streng religiös, ziehen ihre dichterische Kraft aus den Messiashoffnungen und sind erfüllt von dem unwiderstehlichen Drange nach „Zion, der gnadenreichen Stadt“. (491) Man denke an den größten: Jehuda Halevy, dessen Lionide, die höchste Blüte der neuhebräischen Poesie, ganz und gar diesen nationaljüdischen Geist atmet.
Wie eine festgeschlossene Wolke am blauen Himmel zieht das Judentum durch die Geschichte: mit der ebendigsten Erinnerung an ganz alte, heilige Zeiten, wie mit einem frischen Odem jederzeit belebt und erquickt. Noch heute segnet der fromme Jude die Kinder mit den Worten: „Gott lasse dich werden wie Ephraim und Manasse„.
Die wichtige Folge dieser von der Religion bewirkten Zusammenschließung und Absonderung des jüdischen Volkskörpers für das Wirtschaftsleben war nun aber die von uns schon in ihrer Bedeutung gewürdigte Fremdheit: daß aller Verkehr der Juden, sobald sie aus dem Getto heraustraten, ein Verkehr mit Fremden wurde. Weshalb ich an dieser Stelle noch einmal diesen Punkt berühre, sagte ich bereits: um zu zeigen, daß die aus dem Zustande der Fremdheit naturgemaß folgenden eigenartigen Beziehungen durch die Satzungen der jüdischen Religion mit Bewußtsein ihre Sanktionierung erhielten und in ihren äußersten, Konsequenzen entwickelt wurden; daß also auch hier das instinktive Gebaren des Juden als eines Fremden gegenüber den Angehörigen des Wirtsvolkes zur Befolgung eines göttlichen Gebotes wurde; sein besonderes Verhalten also wiederum die Weihe religiös gebotener Gesetzestreue empfing und in einem kunstvoll ausgebildeten Fremdenrechte ausdrücklich gebilligt, wenn nicht gefordert wurde.
Die wichtigste und am häufigsten erörterte Bestimmung dieses jüdischen Fremdenrechtes betrifft das Zinsverbot oder richtiger die Zinsgestaltung. Im alten jüdischen Gemeinwesen (492) war, wie überall (soviel wir zu sehen vermögen) in den Anfängen der Kultur, das zinslose Darlehn (würden wir in heutiger, juridisierender Terminologie sagen) die allein zulässige oder vielmehr die selbstverständliche Form der gegenseitigen Aushilfe. Aber es finden sich auch schon in dem ältesten Gesetz (was auch eine ganz allgemein beobachtete Gepflogenheit war) Bestimmungen des Inhalts: daß man „vom Fremden“ (vom Nichtgenossen also) Zins nehmen dürfe.
Die Hauptstelle, in der dies gesagt ist, findet sich Deut. 23. 20. Andere Stellen der Thora, die auf das Zinsnehmen Bezug haben, sind Ex. 22, 25: Lev. 25, 87. An diese Thorasätze knüpft sich nun seit den Zeiten der Tanaim bis heute eine überaus lebhafte Diskussion, deren Mittelpunkt die berühmten Auseinandersetzungen in der Baba mezia fol. 70 b bilden. Ich habe die Empfindung, als diente ein großer Teil dieser Diskussion ausschließlich dem Zwecke, den außerordentlich klaren Tatbestand, wie er durch die Thora geschaffen ist (und wie er sich übrigens in der Mischna noch fast unverändert findet), durch allerhand Sophismen zu verdunkeln. Deut. 23, 20 sagt deutlich: von Deinem Genossen darfst du keinen Zins nehmen, vom Fremden darfst du. Freilich: Eine Zweideutigkeit lag schon in diesem Urtexte eingeschlossen: bei der Gleichheit von Futurum und Imperativ im Hebräischen kann man die Stelle lesen; vom Fremden „magst du“ und: vom Fremden „sollst du“ „wuchern“ (das bedeutet immer nicht mehr als: Zinsen nehmen).
Für unsere Frage genügt vollständig die Feststellung: der Gläubige fand in der heiligen Schrift Sätze, die ihm das Zinsnehmen, (im Verkehr mit den Goim) mindestens gestatteten: er war also das ganze Mittelalter hindurch von der entsetzlichen Last des Zinsverbotes, unter dem die Christen seufzten, befreit. Dieses Recht ist aber auch von der Lehrmeinung der Rabbinen, meines Wissens niemals ernstlich in Frage gezogen (493). Unzweifelhaft aber hat es auch Zeiten gegeben, in denen die Erlaubnis Zinsen zu nehmen, in eine Pflicht, mit dem Fremden zu wuchern, umgedeutet wurde, in der also die strengere Lesart beliebt war.
Diese Zeiten waren aber gerade diejenigen, auf die es für das praktische Leben ankam: die Jahrhunderte seit dem Hochmittelalter, Es scheint von den Schriftstellern, die in unserer Tagen den Gegenstand behandelt haben, nicht beachtet worden zu sein, daß Deut. 23, 20 mit Bezug auf die Fremden unter die Gebote aufgenommen worden, die das Leben des Israeliten regeln: durch die Tradition ist gelehrt worden, daß man dem Fremden auf Wucher leihen soll. In dieser Form ist das Gebot — es ist das 198. — auch in den Schulchan Aruch übergegangen. Die modernen Rabbiner (494)denen die — ach s0 klaren! — Bestimmungen des jüdischen Fremdenrechts unbequem sind (warum eigentlich?), versuchen dann die Bedeutung solcher Sätze wie das 198. Gebot dadurch abzuschwächen, daß sie behaupten: „Fremde“ im Sinne der Stelle seien nicht alle Nichtjuden, sondern nur „die Heiden“, „die Götzendiener“. Es ist aber immer sehr strittig gewesen, wer zu den einen, wer zu den andern gehört habe. Und der Gläubige, der beispielsweise das 198. Gebot seinem Gedächtnis eingeprägt hat, wird die feinen Unterscheidungen gelehrter Rabbiner nicht gemacht haben: ihm genügte, daß der Mann, dem er auf Zinsen lieh, kein Jude, kein Genosse, kein Nächster, sondern ein Goi war.
Und nun bedenke man, bedenke man: in was für einer ganz andern Lage sich der fromme Jude befand als der fromme Christ in jenen Zeiten, als die Geldleihe über Europa hinging und langsam, aus sich den Kapitalismus gebar. Während der fromme Christ, der „Wucher getrieben“ hatte, sich auf seinem Totenbette, in Qualen der Reue wand und rasch vor dem Ende noch sein Hab und Gut von sich zu werken bereit war, weil es ihm als unrecht erworbenes Gut auf der Seele brannte, überblickte der fromme Jude an seinem Lebensabend schmunzelnd die wohlgefüllten Kästen und Truhen, wo die Zecchinen angehäuft lagen, die er in seinem langen Leben dem elenden Christen- (oder auch Mohamedaner) Volk abgezwackt hatte: ein Anblick, an dem sein frommes Herz sich weiden konnte, denn jeder Zinsgroschen, der da lag, war ja fast wie ein Opfer, das er seinem Gotte dargebracht hatte.
Daß nun aber auch sonst die Stellung des „Fremden“ im jüdischen (göttlichen) Rechte eine Ausnahmestellung war, daß die Verpflichtungen ihm gegenüber niemals so strenge waren als dem „Nächsten“ dem Juden gegenüber: das kann nur Unkenntnis oder Böswilligkeit leugnen. Gewiß haben die Auffassungen des Rechts (und vor allem wohl der Sitte) von der Art und Weise, wie der Fremde zu behandeln sei, im Laufe der Jahrhunderte, Veränderungen erfahren. Aber an dem Grundgedanken: dem Fremden schuldest du weniger Rücksicht als dem Stammesgenossen, ist seit der Thora bis heute nichts geändert worden. Diesen Eindruck hinterläßt jedes unbefangene Studium des Fremdenrechts in den heiligen Schriften (vor allem der Thora) in Talmud, Kodizes und Responsen, Man macht heute noch in apologetischen Schriften die berühmten Stellen in der Thora: Ex. 12, 49; 23, 9: Lev. 19, 33, 34; 25, 44—46; Deut. 10. 18, 19 geltend, um daraus die „fremdenfreundliche“ Auffassung des jüdischen Gesetzes zu erweisen. Aber erstens ist natürlich in einer Halacha, um die es sich hier doch meist handelt, die „mündliche Tradition nicht auser acht zu lassen; und zweitens enthalten doch selbst jene Stellen der Thora zwar die Mahnung, den „Fremdling“ (der natürlich zudem noch im alten Palästina eine ganz andere Bedeutung hatte, wie später in der Zerstreuung: der Ger und der Goi sind doch grundverschiedene Begriffe), den „Fremdling“ zwar gut zu behandeln, „denn ihr seid auch Fremde gewesen im Ägypterlande“ aber doch daneben schon die Weisung, (oder die Erlaubnis), ihn als minderen Rechtes zu behandel: „Also soll es zugehen mit dem Erlaßjahre: wenn einer seinem Nächsten etwas geliehen hat; das soll er nicht einnehmen. Von einem Fremdling magst du es einnehmen; aber dem, der dein Bruder ist, sollst du es erlassen“ (Deut. 15, 2, 3). Es ist immer dieselbe Sache wie beim Zinsennehmen: unterschiedliche Behandlung des Juden und des Nichtjuden. Und begreiflicherweise sind denn die Rechtsfälle, in denen der Nichtjude minderes Recht hat als der Jude, im Laufe der Jahrhunderte immer zahlreicher geworden und bilden im letzten Koder schon eine recht stattliche Menge. Ich führe aus dem Choschen Hamischpat folgende Abschnitte an (die sicherlich nicht alle sind, in denen die differentielle Rechtslage des Fremden ausdrücklich ausgesprochen ist): 188, 194, 227, 231, 259, 266, 272, 283, 348, 389 ff.
Die große Bedeutung des Fremdenrechts für das Wirtschaftsleben erblicke ich nun aber in zweierlei.
Zunächst darin, daß durch die fremdenfeindlichen Bestimmungen des jüdischen Gewerbe- und Handelsrechts der Verkehr mit den Fremden nicht nur rücksichtsloser gestaltet wurde (also daß eine in allem Verkehr mit Fremden liegende Tendenz verschärft wurde), sondern daß auch die Geschäftsmoral, wenn ich es so ausdrücken darf, gelockert wurde. Ich gebe ohne weiteres zu, daß diese Wirkung nicht notwendig einzutreten brauchte, aber sie konnte sehr leicht eintreten und ist gewiß auch in häufigen Fällen namentlich im Kreise der östlichen Juden eingetreten. Wenn beispielsweise ein Satz des Fremdenrechts (er ist oft erörtert worden!) besagte: der von den Heiden (Fremden) selbst begangene Irrtum in einer Rechnung darf von dem Israeliten,zu seinem Vorteil benützt werden, ohne daß eine Verpflichtung bestünde, darauf aufmerksam zu machen (der Satz wurde in den Tur aufgenommen, im Kodex des Karo findet er sich zunächst nicht, wird dann aber durch die Glosse des Isserle hineingebracht): so mußte eine derartige Rechtsauffassung (und von ihr sind zahlreiche andere Gesetzesstellen erfüllt) in dem frommen Juden doch unweigerlich den Glauben erwecken: im Verkehr mit den Fremden brauchst Du’s überhaupt nicht so genau zu nehmen. Er brauchte darum sich subjektiv gar keiner unmoralischen Gesinnung oder Handlung schuldig zu machen konnte im Verkehr, mit den Genossen die außerordentlich strengen Vorschriften des Gesetzes über richtiges Maß und Gewicht so streng einhalten): er konnte im besten Glauben handeln, wenn er den Fremden etwa „übervorteilte“. Zwar wurde ihm in manchen Fällen ausdrücklich eingeschärft: du mußt auch dem Fremden gegenüber ehrlich sein (z. B. Ch. h. 231), aber daß man das schon ausdrücklich sagen mußte! Und dann hieß es ja wieder expressis verbis (Ch. h. 227. 26): „Einen Nichtjuden kann man übervorteilen, denn es heißt in der Schrift 3. Mos. 25, 14, es soll niemand seinen Bruder übervorteilen“ (hier ist nicht vom Betrug die Rede, sondern von einem höheren Preise, den man einem Fremden abnimmt).
Diese ganz vage Auffassung: am Fremden darfst du einen Schmu machen, darfst auch im Verkehr mit ihm mal fünf gerade sein lassen (du begehst damit keine Sünde), wurde nun wohl dort noch gefestigt, wo sich jene formale Rabulistik im Talmudstudium entwickelte, wie in vielen Judengemeinden des Ostens Europas. Wie diese auf das Geschäftsgebaren der Juden laxisierend eingewirkt hat, stellt Graetz anschaulich dar, dessen Worte (da er ja in diesem Falle gewiß ein einwandsfreier Zeuge ist) ich hier ungekürzt wiedergeben möchte (da sie für manchen Zug im wirtschaftlichen Wirken der Aschkenaze die Erklärung enthalten): „Drehen und Verdrehen, avokatenkniffigkeit, Witzelei und voreiliges Absprechen gegen das, was nicht in ihrem Gesichtskreise lag, wurde…… das Grundwesen des polnischen Juden…… Biederkeit und Rechtssinn waren ihm ebenso abhanden gekommen wie Einfachheit und Sinn für Wahrheit. Der Troß, eignete sich das kniffige Wesen der Hochschulen an und gebrauchte es, um den minder Schlauen zu überlisten. Er fand an Betrügerei und Überlistung Lust und eine Art siegreicher Freude. Freilich gegen Stammesgenossen konnte List nicht gut angewendet werden, weil diese gewitzigt waren; aber die nicht-jüdische Welt, mit der sie verkehrten, empfand zu ihrem Schaden, die Überlegenheit des talmudischen Geistes des polnischen Juden ….. Die Verdorbenheit der polnischen Juden rächte sich an ihnen auf eine blutige Weise und hatte zur Folge, daß die übrige Judenheit in Europa von dem polnischen Wesen eine Zeitlang angesteckt wurde. Durch die Abwanderung der Juden aus Polen (infolge der kosakischen Judenverfolgungen) wurde das Judentum gleichsam polonisiert. (496)
Die zweite, vielleicht noch bedeutsamere Wirkung, die die differenzielle Behandlung der Fremden im jüdischen Rechte im Gefolge hatte, war die, daß ganz allgemein die Auffassung von dem Wesen des Handels- und Gewerbebetriebes sich umgestaltete und zwar frühzeitig in der Richtung, wie wir sagen würden, der Gewerbefreiheit und des Freihandels. Wenn wir die Juden als die Väter des Freihandels (und damit als die Bahnbrecher des Kapitalismus) kennen gelernt haben, so wollen wir hier feststellen, daß sie dazu durch ihr früh im freihändlerischen Sinne entwickeltes Gewerberecht (das immer als göttliches Gebot zu gelten hat) nicht zuletzt vorbereitet waren, und wollen ferner feststellen, daß dieses freiheitliche Recht offenbar durch das Fremdenrecht stark beeinflußt worden ist. Denn es läßt sich ziemlich deutlich verfolgen, daß im Verkehr mit Fremden sich zuerst die Grundsätze des personalgebundenen Rechtes lockern und von freiwirtschaftlichen Gedanken ersetzt werden.
Ich verweise auf folgende Punkte.
Das Preisrecht (oder die Preispolitik) steht für den Verkehr mit Genossen in Talmud und Kodizes durchaus noch im Bannkreis der Idee vom justum pretium (wie das ganze Mittelalter überhaupt), erstrebt also eine Konventionalisierung der Preisbildung unter Anlehnung an die Idee der Nahrung: dem Nichtjuden gegenüber wird das justum pretium fallen gelassen, wird die „moderne“ Preisbildung als die natürliche angesehen (Ch. h. 227. 26; vgl. schon B. m. 49b ff.).
Aber woher auch immer diese Auffassung stammen möge: überaus wichtig ist die Tatsache selbst, daß schon im Talmud, und noch deutlicher im Schulchan Aruch gewerbefreiheitliche und freihändlerische Anschauungen vertreten werden, die demgesamten christlichen Rechte des Mittelalters ganz und gar fremd waren. Das durch ein gründliches und systematisches Studium der Quellen einwandfrei und im einzelnen festzustellen, wäre abermals eine dankbare Aufgabe für einen gescheiten Rechts und Wirtschaftshistoriker. Ich muß mich hier wieder mit der Hervorkehrung einiger weniger Stellen begnügen, die aber, wie mir scheint, schon genügen, um meine Behauptung als richtig zu erweisen. Da ist zunächst eine Stelle im Talmud und den Kodizes, die grundsätzlich die freie Konkurrenz zwischen Handeltreibenden anerkennt (also ein Geschäftsgebaren, das, wie wir in anderem Zusammenhange sahen, aller vorkapitalistischen und frühkapitalistischen Auffassung vom Wesen des anständigen Kaufmanns widersprach). B. m. fol, 60a.b lautet (in Sammterscher Ubersetzung): Mischna:
„R. Jehuda lehrt: Der Krämer soll den Kindern nicht Sangen und Nüsse verteilen, weil er sie dadurch gewöhnt, zu ihm zu kommen. Die Weisen jedoch erlauben es. Auch darf man nicht den Preis verderben. Die Weisen jedoch (meinen); sein Andenken sei zum Guten. Man soll nicht die gespaltenen Bohnen auslesen. So entscheidet Abba Saul; die Weisen dagegen erlauben es.“
Gemara: „Frage: Was ist der Grund der Rabbanen? Antwort: Weil er zu ihm sagen kann: ich verteile Nüsse, verteile du Pflaumen“ (!).
In der Mischna stand: „Auch darf man nicht den Preis verderben, die Weisen dagegen sagen, sein Andenken sei zum Guten usw. Frage: Was ist der Grund der Rabbanen? Weil er das Tor (den Preis) erweitert (herabsetzt)„. Auf der Wanderung bis zum Schulchan Aruch sind dann die anti-gewerbefreiheitlichen Rasonnements ganz abgestorben und die „fortgeschrittene“ Auffassung ist allein stehen geblieben: „Dem Krämer ist es erlaubt, den Kindern, die bei ihm kaufen, Nüsse, und dergleichen zu schenken, um sie an sich 21 ziehen, auch kann er wohlfeiler, als der Marktpreis ist, verkaufen, und die Marktleute können nichts dagegen haben.“ (Ch. h. 228. 18.).
Ähnlich lautet die Bestimmung Ch. h. 156, 7: (Kaufleute, die ihre Waren in die Stadt bringen, unterliegen verschiedenen Beschränkungen) „verkaufen aber die Fremden wohlfeiler oder ihre Waren besser als die Stadtleute, so können diese den Fremden nicht wehren, da das jüdische Publikum Vorteil davon hat“ usw. Oder Ch. h. 156, 5: Will ein Jude einem Nichtjuden auf niedrigere Zinsen Geld leihen, so kann der andere ihm das nicht wehren.
Ebenso finden wir im jüdischen Recht das starre Prinzip des Gewerbemonopols zugunsten der „Gewerbefreiheit“ (wenigstens im Schulchan Aruch) durchbrochen: War einer unter den Bewohnern eines Ganges, heißt es Ch. h. 156, v. ein Handwerker, und die andern haben nicht protestiert, und ein anderer von diesen Bewohnern will dasselbe Handwerk anfangen, so kann ihn der erste nicht daran hindern und sagen: er nehme ihm das Brot weg, selbst wenn der zweite aus einem andern Gange (Hofe) wäre usw.
Es kann also keinem Zweifel unterliegen; Gott will den Freihandel, Gott will die Gewerbefreiheit! Welch ein Antrieb, sie, nun im Wirtschaftsleben wirklich zu betätigen!