Farbflecken Ich heiße Patric Gagne, und ich bin eine Soziopathin. Ich bin leidenschaftlich gern Mutter und Ehefrau. Ich bin eine einnehmende Therapeutin. Ich bin unglaublich charmant und beliebt. Ich habe viele Freunde und Freundinnen. Ich bin Mitglied in einem Countryclub.
Farbflecken
Es war spät. Die Lichter der Straßenlaternen spiegelten sich auf dem schwarzen Asphalt des Sunset Boulevards, über den ich hinunter raste. Nach Sonnenuntergang war die Temperatur gefallen und ich trug nur Shorts und ein T-Shirt, aber als ich nach den Heizungsreglern greifen wollte, fiel mir auf, dass ich nicht wusste, wie sie funktionierten. Das Auto gehörte nicht mir. Es war eiskalt, also hielt ich am Straßenrand und überflog das Armaturenbrett, bis ich die Temperaturregler fand. Ich hatte das Auto ein paar Stunden zuvor geklaut und war seither so viel durch die Straßen des spät nächtlichen Los Angeles gedüst, dass ich mir die Knöpfe noch nicht hatte genauer anschauen können. Aber jetzt, wo der Nervenkitzel meiner Tat abgeflaut war, fühlte ich mich nur noch kalt – kalt und distanziert und ungeduldig.
Die Lüftung sprang an, als ich den richtigen Knopf erwischt hatte. Heiße Luft strömte durch die Lüftungsgitter und ich lehnte mich zurück, dankbar für die Wärme. Die Uhr auf dem Armaturenbrett sprang auf null Uhr um und erinnerte mich daran, dass ich erneut die Sperrstunde des Wohnheims verpasst hatte. Ich seufzte, starrte ans Autodach und fragte mich, ob mich die Sperrstunde je tangieren würde, ob mich jemals irgendetwas tangieren würde. Immerhin war der Gedanke daran amüsant, und meine Laune stieg zusammen mit der Temperatur wieder an.
Ein paar Minuten lang saß ich mit dem Auto vor einem CVS geparkt einfach nur da. Auf dem Beifahrersitz lag das Portemonnaie des Autobesitzers. Ich griff danach und suchte mir eine der Kreditkarten raus. Dann stieg ich aus und lief in den Laden, wärmte mich wieder auf, das nächste Abenteuer bereits in den Startlöchern.
Es war nun sechs Monate her, seit ich für die Uni zu Hause ausgezogen war, und absolut nichts verlief nach Plan. In der Oberstufe hatte ich mich entschieden, mich für die UCLA zu bewerben. »Es ist schon ein wenig spät, um sich für Hochschulen außerhalb des Bundesstaats zu bewerben«, hatte meine berufsberatende Lehrerin Mrs. Rodriguez schnippisch kommentiert. Ich saß ihr an ihrem Schreibtisch gegenüber. Hinter ihr hing ein gerahmtes Poster an der Wand, auf dem ein vor mehreren Lamborghinis posierender Mann zu sehen war. Es war mit der Überschrift »Der Grund für eine höhere Bildung« versehen und ich hätte es am liebsten von der Wand gerissen. Sie warf einen Blick auf meine Noten und kommentierte: »Bewerbungen für Schulen außerhalb des Bundesstaats sollten möglichst früh begonnen werden.« Ich hasste Mrs. Rodriguez jetzt schon. Trotz ihrer Vorliebe für farblich an Ostern erinnernde, schlecht sitzende Hosenanzüge konnte ich erkennen, dass sie eine aggressive Regelbefolgerin war. Sie war zudem unfassbar pessimistisch eingestellt, die absolut schlechteste Kombination der Welt. »Tatsächlich lebt mein Vater in Kalifornien«, erklärte ich ihr energisch. »Ich werde also als Bewerberin innerhalb des Bundesstaats angesehen.« Ich hatte damit nicht streitlustig wirken wollen, aber Mrs. Rodriguez sah aus, als hätte sie mir am liebsten eine geklatscht. Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her und nestelte dann an einer raupenförmigen Strassbrosche herum, die scheußlich an ihrem lila Revers glitzerte. »Na ja, davon weiß ich nichts«, kommentierte sie. »Aber ich glaube nicht, dass es jetzt so spät noch Sinn ergibt, sich bei der UCLA zu bewerben, und erst recht nicht, wenn du so viele exzellente Schulen direkt vor der Nase hast! Wie würdest du dich denn fühlen, wenn sich ein kalifornischer Student einfach hier an der Universität bewerben würde, als käme er aus unserem Bundesstaat?«, fragte sie. Ich war mir vollkommen sicher, dass es in mir auf gar keinen Fall irgendwelche Gefühle auslösen würde. Außerdem würde ich mich nicht nach Ratschlägen einer Frau richten, deren Idee von »Erfolg« auf dem reihenweisen Kauf angestaubter Sportautos basierte. Aber darüber würde ich mich jetzt nicht mit Mrs. Rodriguez in die Wolle bekommen.
Meine Entscheidung für die UCLA hatte absolut nichts mit dem dortigen Lehrangebot zu tun, sondern ausschließlich mit Abstand. Auch als Teenagerin kurz vor der Schwelle des Erwachsenenlebens war ich nicht schlauer daraus geworden, was mich von anderen so sehr unterschied. Und, was noch schlimmer war, ich hatte keine weniger destruktiven Wege gefunden, um damit umzugehen. Ich wusste, dass ich bis dato Glück gehabt hatte. Zwischen den spät nächtlichen Verfolgungen und den Erkundungen leerer Häuser hatte ich während meiner Zeit in der Mittel- und Oberstufe meist geheime Ventile für meine Finsternis gefunden. Aber der schmale Grat war schwierig zu meistern. In meinem kleinen, konservativen Kaff war es nur eine Frage der Zeit, bevor meine Glückssträhne endete.
Ich brauche eine Großstadt, dachte ich und stellte mir einen Ort vor, in dem Unsichtbarkeit keine ständige Herausforderung darstellte, wo ich mich einfach unter vielen verstecken konnte. Und eines Abends fiel es mir ein: Los Angeles! Die Stadt, in der mein Vater lebte, würde mir den Luxus bieten, den ich mir immer erhofft hatte: eine natürliche Versenkung, in der ich verschwinden konnte. Mit ihrer enormen Größe und den Millionen Bewohnern und Bewohnerinnen konnte ich in LA sein, wer ich wollte. Ich konnte mich anpassen. Ich konnte verschwinden.
Meine Mutter war wenig angetan von der Idee, dass ich für ein Studium ans andere Ende des Landes ziehen wollte. Aber ich beharrte aus mehreren Gründen darauf. Auch wenn ich meine Familie liebte, musste ich doch von ihr weg – für deren Wohl wie auch für meins. Das war vor allem hinsichtlich meiner Schwester wichtig, deren Fähigkeit, meine Fassade des »braven Mädchens« zu durchschauen, ein Problem geworden war. »Schau dir das mal an«, hatte sie eines Nachmittags gesagt. Wir saßen an einem Samstag im Wohnzimmer, Harlowe malte auf dem Sofa in ihrem Zeichenblock, während ich ein Videospiel spielte. Meine Schwester liebte das Zeichnen und Malen, sie hatte sich zu einer außergewöhnlichen Cartoonistin gemausert. Sie schob mir ihr neuestes Werk vor die Nase, eine Figur, die sie erschaffen hatte. Ins Zentrum der Seite hatte sie ein großes »A« gezeichnet und eine maskierte Superheldin mit einem Umhang. »CAPTAIN APATHY« stand als Titel darunter. »Für Unwahrheit, Unrecht und die Anarchos.« Ich schaute mir das Bild der Umhang tragenden Kreuzritterin und die Worte in der Sprechblase darüber genauer an: »Keine Angst! Captain Apathy kümmert’s nicht!« »Wow«, sagte ich leise. Ich war – untypisch für mich – sprachlos. Harlowe grinste.
»Das bist du«, erklärte sie stolz. »Meine liebste Superheldin, Kaat!« Dann hüpfte sie fröhlich in die Küche, um sich ihren liebsten Snack zu holen: vorsichtig in der Mikrowelle zubereitete Chocolate Chip Cookies. Ich blieb sitzen und starrte düster auf den Cartoon. Ich mochte zwar nicht wissen, was mich von allen anderen abhob, aber ich wusste, dass ich keine Superheldin war. Wenn überhaupt dann war Harlowe meine Superheldin – ein von Natur aus guter Mensch. Sie hatte keine Dämonen zu bekämpfen oder Geheimnisse zu behalten oder destruktive Triebe zu umschiffen. Es wirkte fast so, als hätte ich während meiner Geburt aus Versehen eine extra große Dosis Finsternis bekommen. Ihre Dosis gleich mit dazu. Während ich mit einem Faible für Unfug gesegnet war, war Harlowe es mit reiner Leichtigkeit. Ich hatte immer gewusst, dass die Unterschiede zwischen uns groß waren, aber Captain Apathy zeigte deutlich, dass ich damit nicht allein war.
Zum Glück bot die Uni eine ideale Lösung. Wenn ich wegzog, wusste ich, würde ich mich nicht weiter vor meiner Mutter verstecken müssen oder auf meine Schwester abfärben. Ich konnte mein Leben nach meinen eigenen Regeln leben. Würden meine destruktiven Triebe weggehen, wenn ich gegen nichts
rebellieren musste? Das vermutete ich zumindest. Vielleicht kann ich dann einfach normal sein. Die Worte fuhren eines Nachts wie ein Lichtblitz in mein Hirn und ich wurde sie nicht mehr los. Die Vorstellung eines solchen Lebens – eins, das nicht im Sumpf dunkler Triebe oder ansteigenden Drucks versank – war nie weit weg. Das war etwas, über das ich, solange ich denken konnte, nachdachte, aber ich hatte nie gewagt, mir Hoffnungen zu machen. Bis zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht wird an der Uni alles anders.
Zu Beginn war das der Fall gewesen. Das Leben in Los Angeles war ein Traum, sogar normal. Dad hatte mich vom Flughafen abgeholt, und wir hatten die folgenden Wochen mit Touren durch die UCLA und meinem Einzug ins Wohnheim verbracht. Mein Zimmer lag im zweiten Stock eines umgebauten
Verbindungshauses, von dem man über die Hilgard Avenue blicken konnte. Es hatte deckenhohe Glastüren und einen winzigen dekorativen Austritt, den einzigen im Haus. Ich liebte es. Die ersten paar Tage gehörte das Haus nur mir. Mir war eine Mitbewohnerin zugeordnet worden – ihr Name stand mit Kreide neben meinem auf der Tür –, aber ich wusste nicht, wer sie war und wann sie ankommen wollte. Während die Tage vergingen, hatte ich die kleine Hoffnung, dass sie vielleicht gar nicht auftauchen würde. Aber meine Träume des Einsiedlerdaseins wurden enttäuscht, als am Tag vor Semesterbeginn die Tür aufflog und eine wunderschöne Chinesin mehrere große Koffer über die Schwelle schleppte. »Hi, ich bin Patric«, sagte ich vorsichtig. Das Mädchen starrte mich mit bezaubernden großen Mandelaugen an. Dann griff sie in ihre gewaltige Handtasche. Nach kurzer Suche fand sie eine kleine silberne Box, die ungefähr die Größe eines Taschenrechners hatte. Auf der einen Seite hatte sie einen Lautsprecher, auf der anderen ein Mikro. Sie sprach schnell in die Box, die ihr Mandarin ins Englische übersetzte und mit monotoner männlicher Stimme aus den Lautsprechern presste: »Schön dich kennenzulernen mein Name ist Kimi.« »Ein Übersetzer!« Ich starrte auf die magische Box. »Du nimmst das überallhin mit?« Die Box kommunizierte meine Frage an Kimi, die enthusiastisch nickte. Kimi war eine Austauschstudentin. Sie war vorher noch nie in den Vereinigten Staaten gewesen und sprach kein Englisch. »Übersetzer, ja«, sagte Kimi. »Maschine.« Sie tätschelte die Box. »Es ist auf jeden Fall schön, dich kennenzulernen, Kimi«, sagte ich. Dann wandte ich mich an die Box, »Und dich, Maschine.« Ein Zimmer mit Aussicht und eine Mitbewohnerin, die nicht mit mir reden kann, dachte ich. Das Leben hätte nicht wunderbarer sein können. Am Anfang war ich glücklich von den Kursen und Aufgaben überfordert. Ich mochte es, so beschäftigt zu sein. Wenn ich nicht gerade lernte oder in einem Kurs saß, dann erkundete ich den Campus. Meine große Menge an Kursen, in Kombination mit der Neuartigkeit meiner Umgebung, verbrauchte all meine Hirnleistung. Jede Nacht ließ ich mich erschöpft ins Bett fallen und schlief tief und fest ein, um am nächsten Morgen wieder erfrischt und erholt aufzuwachen. Das war wundervoll. Das war kraftvoll. Das war normal. Aber es hielt nicht allzu lange an. Nach dem ersten Semester verlangsamte sich das Tempo. Da ich jetzt nicht mehr von der Geschäftigkeit der Eingewöhnung erfüllt wurde, setzten die bekannten Gefühle der Rastlosigkeit und Apathie wieder ein. Ich konnte den ansteigenden Druck und den akuten Stress spüren, der immer damit einherging. Ich hatte nach wie vor meine neu gewonnene Freiheit, aber der Frieden war weg. Ohne all die Ablenkungen waren meine destruktiven Triebe wohl doch noch weiterhin sehr präsent. Und ohne mein praktisches Kinderzimmerfenster musste ich erneut kreative Ventile für meinen Druck finden. »Captain Apathy«, sagte ich.
Ich lehnte an der Wand, von der aus man den Hof hinter meinem Wohnheim überblicken konnte, und wartete auf den Sonnenuntergang. Unter mir fiel der Hang mit dem Großteil des Campus ab. Ich liebte diese Aussicht inzwischen, vor allem am späten Nachmittag, wenn der kalifornische Himmel alles
blutorange färbte. Ein paar Typen fuhren unterhalb von mir auf dem Treppenabsatz mit ihren Skateboards. Ich sah einen dabei böse hinfallen und sich das Knie aufreißen. Mehrere Zuschauer rannten hin, um Erste Hilfe zu leisten, um ihm hochzuhelfen. Aber ich starrte einfach nur. »Keine Angst. Captain Apathy kümmert’s nicht«, flüsterte ich.
Ich seufzte und drehte mein Gesicht in Richtung des schwindenden Lichts. Ich bin ein Paradox, war mein einziger Gedanke. Mich kümmerte nichts, außer die Tatsache, dass mich nichts kümmerte. Und genau das ließ in mir das Gefühl aufkommen, dass ich jemanden erstechen wollte. Immerhin verstand ich inzwischen besser, woran das lag.
Die Einführung in die Psychologie war mein liebster Kurs in diesem ersten Jahr. Ich hatte schon immer meine Probleme damit gehabt, meine eigenen antisozialen Verhaltensmuster zu verstehen, und gedacht, dass der Kurs mir ein paar Erkenntnisse liefern würde. Aber wie viele Erkenntnisse ich bekommen würde, hätte ich nie für möglich gehalten. Unsere Professorin Dr. Slack war eine Psychologin, die ich ab der ersten Minute mochte. Der Kurs war ein Überblick, der mit einer Einführung in die »normale« Psyche begann. Die meisten Menschen, so erklärte sie uns, würden mit einer großen Bandbreite an Emotionen geboren, und die psychische Gesundheit einer Person sowie ihre Neigungen zu abnormalen Verhaltensweisen beruhten weitestgehend auf der Angemessenheit ihrer emotionalen Reaktionen. Menschen mit extremen Reaktionen und Verhaltensweisen würden manchmal mit mentalen Krankheiten oder Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert. Wichtig dabei sei allerdings, dass diese Extreme in beide Richtungen gingen. Wir erfuhren, dass es zu jenen, die zu viele Emotionen fühlten, auch andere gab mit zu wenigen. Deren Persönlichkeitstypen würden nicht anhand der Anwesenheit von Gefühlen, sondern anhand deren Abwesenheit kategorisiert. Es dürfte nicht überraschen, dass diese Persönlichkeitstypen mich am meisten interessierten.
»›Apathie‹ ist ein anderer Begriff für dieses Fehlen der Gefühle«, erklärte uns Dr. Slack. Der Kurs lief seit ungefähr einem Monat und wir hatten einen Abstecher in Richtung antisozialer Psychologie gemacht. »Apathie ist das charakteristischste Merkmal vieler antisozialer Störungen«, sagte sie. »Nehmen wir Soziopathen, zum Beispiel.« Dr. Slack hielt inne und schrieb ein Wort an die Tafel. »Soziopathie ist eine Störung, die von einer Abneigung zur Empathie gekennzeichnet ist«, fuhr sie fort. »Aus psychologischer Sicht sind Soziopathen nicht sonderlich gut darin, Mitleid zu empfinden. Sie fühlen sich nicht schuldig wie alle anderen. Sie verarbeiten Emotionen nicht wie alle anderen. Sie fühlen nicht wie alle anderen. Und viele Forscher gehen davon aus, dass es dieser Mangel an Gefühlen ist, der sie zu ihrem aggressiven und destruktiven Verhalten verleitet. Das unterbewusste Verlangen, endlich etwas zu fühlen, zwingt Soziopathen dazu, sich so auszuleben.« Ich war völlig fasziniert. Das war das erste Mal, dass ich jemanden den Begriff erklären hörte. Officer Bobby hatte mithilfe von ihm die Männer im Gefängnis beschrieben und ich hatte fast ein Jahrzehnt lang versucht, eine Definition zu finden. Das hatte sich im Laufe der Jahre zu einer Art Spiel entwickelt. Immer, wenn ich ein Wörterbuch in den Händen hielt, suchte ich nach »Soziopath« und wurde jedes Mal enttäuscht. Entweder gab es das Wort gar nicht oder die Definition brachte mir keine sinnvolle Erkenntnis. Es war, als existierte es gar nicht. Ich aber hatte immer gewusst, dass es den Begriff wirklich gab, und jetzt begegnete er mir hier.
Dr. Slacks Vortrag hätte genauso gut einfach über mich sein können, wenn es nach mir gegangen wäre, und ich konnte die Informationen gar nicht schnell genug in mich aufsaugen. Zugegeben, ich wusste, dass das keine »normale« Reaktion war. Die meisten Nicht-Soziopathen würden keine Welle an
Erleichterung verspüren, wenn sie sich selbst als Soziopath identifizieren würden, so weiß ich jetzt. Aber ich war begeistert. Ich hatte mich immer nach einer Art Beweis gesehnt, dass ich nicht allein war, nach einer Bestätigung, dass ich nicht die einzige Person auf der Welt war, die die Dinge nicht so fühlte wie alle anderen. Ich hatte es immer geahnt, aber jetzt wusste ich es mit Sicherheit. Es gab genug Menschen wie mich, um eine ganze psychologische Kategorie zu erfordern. Und wir waren nicht »schlecht« oder »böse« oder »verrückt«, sondern hatten es nur schwerer beim Thema Gefühle. Wir benahmen uns daneben, um die Leere zu füllen.
Auf einmal war alles so einfach. Der Druck, den ich mein gesamtes Leben lang gespürt hatte, war wahrscheinlich mein Unterbewusstsein, das etwas fühlen wollte. Das war keine rebellische Ader, die ausgemerzt werden musste, sondern eher ein psychologischer Software-Bugfix, mit dem mein Gehirn meinen Mangel an Gefühlen ausgleichen wollte. Meine schlechten Taten waren tatsächlich eine Art Selbstschutz. Sie glichen meine Apathie aus. Meine innere Gefühlswelt war, wie Harlowes Captain-Apathy-Zeichnung, schwarz-weiß. Indem ich etwas tat, bei dem ich wusste, dass es auf moralischer Ebene inakzeptabel war, erzwang ich einen Farbfleck. Ich sehnte mich danach. Und das war auch der Grund, weshalb ich mich in dieser einen Nacht während meines ersten UCLA-Jahrs in einem gestohlenen Auto wiederfand, mit dem ich durch die Straßen von Los Angeles cruiste.
Der Besitzer war ein sternhagelvoller Verbindungstyp namens Mike, der Erbe einer Kartoffelchipdynastie. Er war nicht mein erstes Opfer. In der zweiten Hälfte dieses ersten Jahres konnte ich mich immer darauf verlassen, Gefühle zu finden, wenn ich auf Verbindungspartys ging und mir Autos »lieh«. Auch wenn das erste Mal ein reiner Zufall gewesen war. Ich war ein paar Wochen vor Weihnachten auf einer Samstagsparty im Sigma-Phi-Epsilon-Haus gewesen. Ich war leicht angetrunken. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich bereits verstanden, welche Konsequenzen es haben würde, wenn ich den Druck ungebrochen ansteigen ließ, und war gerade genervt von mir selbst, dass ich ihn so lange hatte schwelen lassen. Als mir Kommilitonen von der Party erzählten, ging ich mit. Ich ließ kaum eine Möglichkeit zum Feiern aus, aber nicht aus den Gründen, die die meisten nachvollziehen könnten. Diese Partys waren einfach mit die besten Orte in der Stadt, um Menschen zu beobachten. Diese Versammlungen waren eine richtige Master Class der sozialen Interaktionen und boten so ziemlich jede denkbare Art der Verhaltensbeobachtungen an. Die Teilnahme an einer war wie ein osmotischer Gefühlsschub.
Je größer die Party war, desto einfacher war es für mich. Ich tauchte auf, tauchte dann in der Flut an Fremden wieder ab und genoss die Unsichtbarkeit. Manchmal schnappte ich mir einen Stuhl in einer Ecke und saß einfach da. Ein anderes Mal lief ich durch die Zimmer. Die Partygänger, mit all ihren lebhaften Antworten und emotionalen Reaktionen, waren so extrem anders als ich – aber auch so interessant. Diese Beobachtungen halfen mir, für mich die richtigen Gesichtsausdrücke zu identifizieren und korrekt bei anderen zu nutzen – mit minimaler eigener Interaktion. Ich war wie eine Emotionsanthropologin. Nach Wochen solchen »Feierns« entdeckte ich etwas Wichtiges:
Eine innere Emotion war keine Voraussetzung für eine externe Reaktion. Ich musste nichts fühlen, um so zu tun, als würde ich es tun. Solange ich die richtige körperliche Reaktion zum richtigen Sachverhalt abgab, konnte ich mich wie alle anderen verhalten.
Ich konnte das richtige Verhalten nachahmen. Das war nicht das erste Mal, dass mir dieser Gedanke gekommen war. Ich hatte während unserer Kindheit oft meine jüngere Schwester auf emotionale Anhaltspunkte hin beobachtet. So war ich die (meiste) Zeit bis jetzt unbemerkt durchs Leben gekommen, ich hatte das »brave Mädchen« gespielt. Ich hatte meine Schwester gespielt. Das Problem war nur gewesen, dass diese Tarnung nie so richtig zu mir passen wollte. Harlowe, mit all ihren emotionalen Tiefen und ihrer unbegrenzten Empathie, war kein bisschen wie ich. Ihre Persönlichkeit war für mich wie ein zwei Nummern zu kleines Kleid. Das ging eine Weile gut, aber niemals lang. Ich brauchte Diversität, brauchte Persönlichkeitsmerkmale, die ich mir zusammenflicken könnte, um mir eine maßgeschneiderte psychologische Tarnung zu erschaffen. Und jetzt hatte ich endlich das Material dafür.
Die Partys waren wie ein Zugang zu einer unbegrenzten Menge Stoff, mit der ich meine Tarnung nähen konnte. Ich experimentierte mit möglichst vielen Gefühlen und änderte sie dann für eine möglichst gute Passgenauigkeit ab. Ich übte allein in meinem Zimmer Eigenarten, die ich bei anderen auf den Partys gesehen hatte. Sobald ich sie perfektioniert hatte, testete ich sie in der freien Wildbahn. Die Ergebnisse waren atemberaubend.
Ich lernte, dass es mein Gegenüber im Gespräch entspannte, wenn ich dessen Arm kurz berührte. Ich lernte auch, dass man Fremde am einfachsten entwaffnete, wenn man ein Gespräch mit einem Kompliment oder einer unerwarteten Frage begann.
Ich fing an, diese Praktiken in meinen Alltag einzubauen, und war erstaunt über den sofortigen Unterschied. Das erste Mal in meinem Leben schienen Menschen mit mir warm zu werden – und das auf ganz authentische Art. Es war völlig egal, dass wiederum nichts an meinen Interaktionen authentisch war. Meine Kommilitonen hatten plötzlich Bock, mit mir auf dem Campus zu quatschen, während mich andere im Wohnheim für kurze Gespräche im Zimmer besuchten. Diese Veränderungen, die kaum jemandem affielen, waren für mich unglaublich wirkmächtig, wie Brotkrumen, die mich entlang des Wegs in Richtung sozialer Eingliederung führten.
Um aber eins zu verdeutlichen: Mir ging es dabei nicht um Anerkennung, sondern Integration. Ich wollte nicht auffallen. Ich hatte mein ganzes Leben lang untertauchen wollen. Aber an der Uni fiel mir auf, dass ich es auf dem falschen Weg versucht hatte. Denn der Trick, um unsichtbar zu werden, lag nicht in der Isolation, sondern in der Infiltration, in der Assimilation. Indem ich mir die Persönlichkeiten anderer zu eigen machte, schaute mich niemand mehr so an wie früher. Mal wieder war Unehrlichkeit die sichere Wahl. Versteckt hinter meinen Persönlichkeitsstoffen war ich im Grunde genommen unsichtbar. Das war ein riesiger Durchbruch für mich. Ich hasste es, dass Menschen irgendwie immer meine Andersartigkeit zu spüren schienen. Sie ließ mich hervorstechen. Auffallen. Aber jetzt hatte ich Hilfsmittel.
Was auch immer anderen an mir unangenehm war, war jetzt unwichtig geworden. Ich konnte sie einfach ablenken, indem ich sie nachahmte. Das war ein wenig wie Zauberei, denn in dem Moment, in dem ich eine neue Person traf, übernahm ich deren Haltung, imitierte ihre Eigenarten, kopierte ihren Sprachduktus, fand ihre Vorlieben und Abneigungen heraus, um sie dann für mich zu übernehmen. Der Effekt war wie ein riesiger Spiegel, den ich den Menschen vorhielt. Männer, Frauen, jung und alt – es war einerlei. Die Menschen waren immer wie verzaubert – nicht von mir, sondern von der Spiegelung ihrer selbst. Ich musste einfach nur ihr Verhalten nachahmen.
Das Verhalten, das ich bei verschiedenen geselligen Treffen beobachtete – und übte. Zugegeben, meine Herangehensweise an den Lernprozess musste ich ab und an korrigieren. So fand ich zum Beispiel heraus, dass es nicht gerade meinem Ziel diente, auf Verbindungspartys auf einem Stuhl in der Ecke zu sitzen und Beobachtungen in meinem Notizbuch festzuhalten. Von dieser Warte aus sah ich normalerweise nur Reaktionen extremen Unbehagens. Also suchte ich mir nun leere Zimmer, aus denen ich ungesehen durch ein Fenster oder eine Tür lauschen und/oder schauen konnte, statt Menschen so zu beobachten, dass ich selbst gesehen werden konnte. Irgendwann bewertete ich die Verbindungspartys auf Basis ihrer Örtlichkeit. Anstatt nach den physischen Attributen der Mitglieder stufte ich sie nach den Schleich- und Versteckmöglichkeiten ihrer Gemeinschaftsräume ein. Ich wusste beispielsweise, dass das Delta-Tau-Delta-Haus älter, größer und weiter von der Straße entfernt lag als andere. Das bot mir weitaus mehr Versteckmöglichkeiten, als zum Beispiel das Pi-Kappa-Phi-Haus, das kleiner war und keine ebenerdigen Fenster an der Außenfront hatte. Ich führte sogar eine Liste fast aller Greek-Häuser der UCLA, auf der ich die besten Versteckplätze festhielt. Mein Lieblingsort war das Esszimmer bei Sigma Phi Epsilon. Darin gab es Schiebetüren mit Fenstern, die mir einen fast uneingeschränkten Blick in die anderen Aufenthaltsbereiche gewährten, sowie deckenhohe Glasschiebetüren zum Garten hin. Solange die Türen geschlossen waren und die Lichter aus, konnte ich aus zwei Blickwinkeln Menschen beobachten – und das stundenlang.
Der Hauptgrund, weshalb ich mich so auf die Party am Samstag freute, war der Veranstaltungsort: das Sigma-Haus. Für mich klang ein Abend, den ich mit Menschenbeobachtungen aus meinem Versteck heraus verbringen konnte, nach einer wunderbaren Beschäftigung. Ich ging sofort und schnurstracks nach meiner Ankunft zu meinem üblichen Standort, wurde aber auf dem Weg von einem sehr betrunkenen Verbindungsbruder über den Haufen gerannt. »Oh nein!«, stammelte er, während er sein Gleichgewicht wiederfand und mir unbeholfen versuchte, auf die Beine zu helfen. »Das tut mir so leid! Geht’s dir gut?« »Ja, kein Problem«, erwiderte ich und hob meine Tasche auf. »Ich heiße Steve«, sagte er weiter, mit langsam blinzelnden trüben Augen. Im Gegensatz zu den meisten nüchternen Partygängern machte mir die Interaktion mit Betrunkenen Spaß. Deren Erinnerungen an mich am nächsten Morgen waren im besten Fall gerade einmal schwammig. So war ich wie eine Art Gespenst. Steve grinste und zeigte mit einem wackligen Finger auf meine Brust. »Hey.« Er hielt inne. »Kenne ich dich nicht irgendwoher?« »Nein«, erwiderte ich lachend. »Ja, doch«, fuhr er fort, als hätte ich nichts gesagt. »Du bist Sarah.« Ich sagte nichts dazu und war einen Augenblick lang verblüfft, als er seinen Körper gegen meinen drückte und mich somit gegen die Wand im Flur. Steves Lippen berührten mein Ohr. »Weißt du was?«, flüsterte er. »Ich habe keine Kippen mehr. Hol’ uns welche, und ich schuld’ dir ’nen Gefallen.« Er ging einen ungeschickten Schritt nach hinten und drückte mir einen Schlüsselbund in die Hand. Ich stand da und wusste nicht, was ich tun sollte. Steve missverstand meine Verwirrung als Widerwillen, nickte mit dem Kopf und wedelte erneut mit dem Finger durch die Luft, wie eine Art unausgesprochenes Einvernehmen, an dem ich keinen Anteil hatte. »Ah, richtig«, lallte Steve, griff sich in die Tasche und überreichte mir ein dickes Portemonnaie. »Schon verstanden. Hol’ dir was Schönes.« Er grinste, drehte sich um und torkelte den Flur entlang wieder in Richtung Wohnzimmer. Dort kollabierte er auf dem Sofa und verfiel in eine Art komaähnliche Bewusstlosigkeit. Ich betrachtete die Schlüssel und das Portemonnaie in meiner Hand. Nur wenige Augenblicke zuvor hatte ich gedacht, ich würde den Abend allein in einem dunklen Zimmer verbringen und Menschen bei ihren Interaktionen beobachten. Und das wäre völlig fein gewesen. Aber das hier war so viel besser! Das Auto ließ sich leicht finden. Ich hielt den Schlüsselbund über meinen Kopf und lief über den Parkplatz, während ich den Knopf auf dem Autoschlüssel drückte. Irgendwann leuchteten die Lichter von Steves Acura auf einem Stellplatz in einer Ecke auf. Ich öffnete die Tür und warf meine Tasche sowie Steves Portemonnaie hinein. Nachdem ich mich in den Fahrersitz hatte gleiten lassen, steckte ich den Schlüssel in die Zündung. Einige Augenblicke saß ich einfach da und genoss dieses unerwartete Glück. Dann ließ ich den Motor an.
Ich nahm die Sunset Avenue in Richtung Strand, hielt mich dann nach Norden auf dem Pacific Coast Highway, den ich meilenweit parallel zum Meer einfach entlangfuhr. Bei den Bergen entlang der Küste Malibus bog ich rechts ab und durchquerte Calabasas, hinein in die Vororte des San Fernando Valley. Ich fuhr fast eine Stunde lang auf dem Ventura Boulevard in Richtung Osten, bog dann gen Süden ab, durch die Hollywood Hills und entlang der Ebenen von Beverly Hills, bevor ich mich wieder in Richtung UCLA-Campus aufmachte. Es war fast zwei Uhr, als ich schließlich an einem Laden anhielt. Ich dachte mir, dass es so am klügsten war. Ich schnappte mir eine Packung Fruchtgummis und ging zur Kasse. Die Zigaretten waren dahinter in einem Glasschrank eingeschlossen. Ich bat den Verkäufer um eine Packung der Marke, die ich zerknüllt auf dem Boden im Auto gesehen hatte, und überreichte ihm Steves Kreditkarte. Ich ging nicht davon aus, dass er mich nach meinem Ausweis fragen würde, aber lenkte ihn dennoch sicherheitshalber mit meinem Charme ab. Ich lehnte mich nach vorn und berührte lässig mit meinem Handrücken sein Handgelenk, während ich ihm tief in die Augen schaute. »Was ist das Verrückteste, was du hier um die Uhrzeit je erlebt hast?«, fragte ich ihn, tatsächlich neugierig. Das überrumpelte den Verkäufer. »Das Verrückteste?« Er ließ die Karte durch den Scanner gleiten und gab sie mir gedankenverloren zurück. Dann leuchtete sein Gesicht auf. »Einmal hab’ ich einer Dame geholfen, von einem Typen wegzukommen, der sie verfolgte«, erzählte er. »Krasser Scheiß!«, erwiderte ich, wirklich überrascht. »Gut gemacht!« Ich schnappte mir die Zigaretten und wünschte ihm beim Rausgehen eine gute Nacht über die Schulter.
Kurze Zeit später setzte ich den Acura vorsichtig in seinen Stellplatz neben dem Verbindungshaus. Ich wusste, dass mein Abenteuer ein Ende gefunden hatte, konnte mich aber noch nicht dazu überwinden, die Tür zu öffnen. Das Gefährt fühlte sich wie eine Dekompressionskammer an. Es war belebend gewesen, in Steves Auto durch die Stadt zu fahren – genau der Fleck Farbe, den ich gebraucht hatte. Ich saß still in der Dunkelheit und bemerkte all die Gefühle, die sich langsam wieder in Luft auflösten. Ihre Wirkung ließ mich entspannt zurück, fast schon schläfrig. Ich lehnte mich im Sitz nach hinten. In Steves CD-Spieler lief gerade The Joshua Tree von U2. Ich schloss die Augen und stellte mir meine eigene Version eines der Texte zusammen. »She will suffer the feeling thrill / She’s running to stand still.« Genauso fühlte es sich an – als ginge es bei meinem Verlangen nach etwas Farbe in meinem Leben nicht um die Gefühle an sich. Stattdessen sollte es eher meine Erfahrungen mit Gefühlen ausreizen, damit ich endlich stehen bleiben konnte – damit ich die Apathie ohne Druck oder den eingeklemmten Stress erleben konnte. »Wenn ich mich jetzt also angenehm apathisch fühle, was lässt das Ganze dann kippen? Warum fühlt es sich irgendwann unangenehm an?«, fragte ich mich und dachte darüber nach, wie der eingeklemmte Stress immer mit Druck und der ihm so ähnlichen klaustrophobischen Art der Angst einherging. Dann schüttelte ich in wachsender Frustration den Kopf.
»Wie bitte kann sich jemand gleichzeitig ängstlich und apathisch fühlen?« Ich hatte zu gute Laune, um jetzt darüber nachzudenken, und schob die Gedanken von mir. Stattdessen schaute ich schläfrig aus dem Fenster. Ich ruhte noch ein paar Minuten lang zufrieden im Auto, bevor ich schließlich den Schlüssel aus der Zündung zog. Ich schmiss sie, mit den Zigaretten und dem Portemonnaie, auf den Beifahrersitz. Dann stieg ich aus und lief zu meinem Wohnheim, dabei bereits überlegend, wie ich so etwas noch einmal hinbekommen könnte. Ich brauchte nicht lange für einen Plan. Diese spontane Spritztour war die erste von vielen. In den folgenden Monaten unternahm ich Dutzende solcher nächtlicher Trips – auch wenn sie danach deutlich absichtsvoller vonstatten gingen. Ich hatte festgestellt, dass ich weniger teilnahmslos durch die Welt ging, wenn ich wusste, dass ich bald wieder mit einem Auto durch die Stadt fahren würde, das mir nicht gehörte. Nicht so sehr der Akt an sich, sondern die Vorfreude auf den Nervenkitzel reduzierte dabei den Druck.
Sobald ich die treibende Kraft hinter meinen Zwängen verstanden hatte – dass ich, wie Dr. Slack erklärt hatte, unterbewusst dazu motiviert wurde, etwas, irgendetwas, zu tun, um meine apathischen Ausgangswerte hochzusetzen –, machte ich mir weniger Gedanken über sie. Sie hatten sich normalisiert. »Normalisierung ist ein therapeutisches Tool, mithilfe dessen ein bis dato als abnormal oder auffällig angesehener Geisteszustand als ›normal‹ umdefiniert wird«, erklärte Dr. Slack, während sie das Wort auf der Kreidetafel unterstrich.
»Die Normalisierung von psychischen Störungen – vor allem deren verschiedenen Symptomen – ist unerlässlich, um gegen das Stigma, das mit diesen Symptomen einhergeht, vorzugehen und es durch Wissen, Verständnis und irgendwann sogar Akzeptanz zu ersetzen.«
Diese Erklärung fand großen Anklang in mir und führte zu einer wichtigen Veränderung in meinem eigenen psychologischen Bewusstsein. Auch wenn ich erkannt hatte, dass meine destruktiven Triebe aus allgemeiner Sicht nicht »normal« waren, so waren sie doch typisch für Menschen wie mich. Ich bin also nicht verrückt, dachte ich. Die Erleichterung war sowohl unerwartet als auch überwältigend. Auch wenn ich es nie meine Gedanken habe beherrschen lassen, war ein Teil von mir doch immer unangenehm berührt gewesen von meinem andersgearteten Persönlichkeitstypus. Das Schlimmste war, dass ich das alles, aber vor allem die destruktiven Triebe, nicht verstand. Jetzt, wo ich aber eine Ahnung davon hatte, was sie hervorrief, waren meine Reaktionen darauf für mich viel einfacher zu managen: Ich musste einfach aufs Wochenende warten.
Die Verbindungen der UCLA organisierten jeden Freitag- und Samstagabend riesige Events auf der Griechischen Partymeile. Ich lief durch die schmale Straße und hielt Ausschau nach dem Haus mit der lautesten und chaotischsten Party, zu der ich mich dann dazugesellte, mir den betrunkensten Typen raussuchte, um ihn geschickt um seine Autoschlüssel zu bringen. Manchmal fuhr ich schnell, manchmal langsam. In manchen Nächten fuhr ich weit weg, in anderen nur ein paar Blöcke. Das Einzige, was diese Fahrten gemeinsam hatten, war die Erleichterung über den gelinderten von der Apathie ausgelösten Stress und der Trost über das Wissen, dass ich eine zuverlässige, wenn auch nur
vorübergehende Lösung gefunden hatte.
Ich verstand die möglichen Konsequenzen meines Verhaltens. Falls ich jemals in einem entwendeten Auto aufgegriffen werden würde, wären Verhaftung und sogar eine Gefängnisstrafe sehr plausible Resultate. Aber es kümmerte mich nicht. Das ist das Problem mit Menschen wie mir, dachte ich, während ich einen schnittigen BMW durch den Drive-in des In-N-Out-Burger-Ladens in Westwood manövrierte. Es kümmert uns nicht. Ich fürchtete eine Inhaftierung nicht; es war fast eher ein Anreiz. Ich erinnerte mich noch, wie die Gefangenen von Officer Bobby vor sich selbst geschützt waren. Eine kleine Runde im Knast klang interessant.
Wenn ich keinerlei Stimulation und keinen Ausweg hatte, würde ich mich dann, so fragte ich mich, immer noch nach den emotionalen Farbflecken sehnen? Oder wäre meine innere Schwarz-Weiß-Welt dann einfach zu managen? Ein Teil von mir wollte das herausfinden. Allerdings wusste ich, dass es nicht sonderlich wahrscheinlich war, dass ich je gefasst werden würde. Keiner der Typen meldete je sein Auto als gestohlen. In den meisten Fällen wurden mir die Schlüssel willentlich, wenn auch nicht nüchtern ausgehändigt. Sie waren meist zu besoffen, um sich daran zu erinnern, dass sie überhaupt ein Auto besaßen, geschweige denn merkten, dass es weg war. Selbst wenn einer bemerken sollte, dass sein Auto weg war und ich es mir geschnappt hatte, wusste ich schon, wie ich es erklären würde.
»Hier sind deine Chips, Süßer.« Ich warf meinem neuesten Opfer, der über einen Sitzsack ausgestreckt im Wohnzimmer eines Verbindungshauses lag, eine Packung Doritos zu. Er öffnete die Augen und rieb sich die Stirn, im verzweifelten Versuch, klarer zu sehen. »Hey, Hübsche«, murmelte er lächelnd. »Wo warst du denn?« »Dir ein paar Chips besorgen. Hattest du mich doch gebeten«, erwiderte ich herzallerliebst und gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. »Hier sind deine Schlüssel.« Ich warf sie ihm zu. »Bis später.« Wie bei jedem anderen meiner ahnungslosen Opfer hatte ich keinerlei Interesse daran, noch mit ihm zu quatschen. Ich war müde und entspannt von meiner nächtlichen Spritztour. Jetzt wollte ich einfach zurück ins Wohnheim und dort ins Bett. Ich schaffte es zur Tür hinaus, bevor er mich eingeholt hatte.
Die Nachtluft war kühl, aber es kümmerte mich nicht. Es erinnerte mich vielmehr an die Nacht, als ich in San Francisco von der Pyjamaparty nach Hause gelaufen war. Die Straßen waren leer gewesen, die Häuser verschlafen. Die Nacht voller Möglichkeiten. Als ich mein Wohnheim erreichte, lief ich an der
Haustür vorbei. Ich hatte die Sperrstunde verpasst, nach Mitternacht wurden immer alle Außentüren verschlossen und man kam nur noch mit einem Anruf beim Wohnheimbetreuer rein. Natürlich hatte ich keinerlei Absicht, irgendjemanden auf meine nächtlichen Fahrten aufmerksam zu machen, also hatte ich mir vor Beginn des Abends eine andere Lösung arrangiert. Ich stellte immer sicher, dass das Fenster der Hausmeisterkammer am hinteren Ende des Gebäudes nicht abgeschlossen war. Ich drückte erst vorsichtig gegen das Glas, dann zog ich das Schiebefenster nach oben, hievte mich auf den Sims hoch und krabbelte durch die Lücke rein. Im Untergeschoss war alles dunkel, als ich mir den Weg zur Treppe bahnte. Ich stieg schnell in den zweiten Stock und lief auf Zehenspitzen den Flur zu meinem Zimmer entlang. Leuchtstoffröhren tauchten den Flur in grelles Licht und ich öffnete die Tür möglichst vorsichtig, um meine Mitbewohnerin nicht zu wecken.
Kimi hasste meine nächtlichen Ausflüge. Das hatte sie mir schon mehrmals gesagt. Sie hatte einen leichten Schlaf, wie sie mir via ihres Übersetzers erklärte. Das leiseste Geräusch weckte sie. Allerdings war das leider in dieser Nacht meine kleinste Sorge. Die Flurlichter waren im Vergleich zur Dunkelheit im Zimmer wie Flutlichter in einem Stadion. Ich machte beim Betreten des Zimmers keinerlei Geräusche, aber die aggressiven Strahler über mir stürmten noch vor mir rein, erhellten das Zimmer und schreckten Kimi auf. Sie riss die Hände zu den Augen, als sei sie verbrannt worden. »Herrgott noch mal«, sagte ich, meine Verachtung kein bisschen versteckend. »Was ’n Theater.« Ich zog die Tür hinter mir zu und flüsterte ein paar Entschuldigungen, während ich ins obere Hochbett krabbelte, aber sie stießen auf ausländische Ohren. Ich konnte meine Mitbewohnerin im unteren Bett wütend auf Mandarin grummeln hören, während sie sich hin- und herwälzte. Ich musste lächeln. Kimi, so wusste ich, würde ein Treffen einberufen.
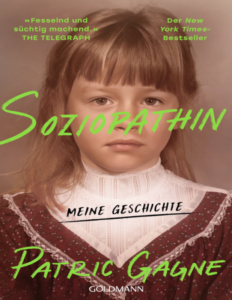
Impressum