Die Vorgeschichte txt
Die Vorgeschichte
»Die mythenbildende Kraft der Volksphantasie hat sich zu allen Zeiten in der Erfindung ›großer Männer‹ bewährt. Das schlagendste Beispiel dieser Art ist unstreitig Simón Bolívar.«
Karl Marx
Hätte Chávez das Ende seiner Revolution in diesen Tagen miterlebt, er hätte angesichts der Verhältnisse wohl ein ähnliches Fazit wie sein großes Vorbild Simón Bolívar ziehen müssen. Der schrieb nach zwanzig Jahren Kampf um die Unabhängigkeit 1830:
- 1. »Lateinamerika ist für uns unregierbar.
- 2. Wer der Revolution dient, pflügt das Meer.
- 3. Das einzige, was man in Amerika machen kann, ist emigrieren.
- 4. Dieses Land wird unweigerlich in die Hände zügelloser Tyrannen fallen, die allen Farben und Rassen angehören.
- 5. Zerfressen von den Verbrechen, erschöpft von der Barbarei, werden uns die Europäer verachten und nicht einmal mehr erobern wollen.«
Ungeachtet dieses deprimierenden Resümees kurz vor seinem Tode, ist außer Ernesto »Che« Guevara kein anderer lateinamerikanischer Freiheitskämpfer so oft abgebildet und verklärt worden wie Bolívar. Straßen und Schulen tragen seinen Namen, die venezolanische Währung, Städte und Provinzen und sogar ein Land – Bolivien. Seit einem Erlass aus dem Jahre 1876 muss in Venezuela der Hauptplatz jedes noch so kleinen Ortes nach dem Libertador (Befreier) benannt werden. Seine Büste ist in Venezuela allgegenwärtig, ob in Amtsstuben, auf Plätzen oder in Parks. Selbst sein Pferd ziert das Staatswappen der heutigen Bolivarischen Republik Venezuela.
Hugo Chávez war dem Befreier förmlich verfallen. Bei seinen Auslandsreisen wurden die Hotels oder Residenzen, in denen er übernachtete, angewiesen, ein lebensgroßes Bild Bolívars aufzuhängen. Bei Kabinettssitzungen blieb neben dem Präsidenten stets ein Stuhl frei, damit sich der Angebetete setzen konnte, sollte er überraschenderweise doch einmal vorbeikommen. Aus jeder Flasche Rum, die er öffnete, goss er den ersten Schluck auf den Boden, mit den Worten: »Für Simón Bolívar«. Wenn er allein sein Essen einnahm, war ein zweites Gedeck auf dem Tisch, und manch ein Kellner berichtete später, Chávez bei einer angeregten Unterhaltung angetroffen zu haben. Auf den verwunderten Blick eines Kellners soll er geantwortet haben: »Ich habe mich gerade mit Bolívar unterhalten.«
2010 ließ Chávez die Gebeine Bolívars aus dem Pantheon in Caracas holen, um sie in Spanien auf ihre Echtheit prüfen zu lassen. Ein Jahr später präsentierte er einen neuen Luxussarg für den nunmehr geprüften echten Befreier. »Wir wissen jetzt zweifellos und für immer, dass Du hier bist, Vater, Du bist hier mit uns, das bist Du«, sagte Chávez bei der Feier im Pantheon. Der neue Mahagoni-Sarg war mit Perlen und Diamanten sowie acht von der venezolanischen Zentralbank gestifteten Goldsternen verziert.
Bis zum 17. Dezember 2030, dem 200. Todestag Bolívars, sollte ein Mausoleum errichtet werden. Wer war dieser Simón José António de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco?
Er wurde 1778 in eine Familie spanischer Aristokraten aus dem Baskenland in Caracas geboren. Sein Vater besaß Bergwerke, Plantagen und Sklaven und war einer der reichsten Venezolaner der damaligen Zeit. Man wurde Ausgang des 18. Jahrhunderts in Südamerika nicht sehr alt – mit neun Jahren war Simón Bolívar bereits Vollwaise und mit 21 Jahren Witwer.
Landläufig sieht man in lateinamerikanischen Kämpfern verwegeneGesta lten mit üppigen Schnauzbärten, mit viel Temperament und wenig Plan. Bolívar war das Gegenteil: Seine Erscheinung war nicht sehr eindrucksvoll, er war klein und schmächtig, dafür aber von überragendem Geist. Er gehörte zweifellos zu den weltweit bedeutendsten Denkern und Politikern des 19. Jahrhunderts.
Der Kämpfer für die kontinentale Unabhängigkeit Simón Bolívar (1783 – 1830) Bolívar hatte Glück mit seinen Lehrern: Andrés Bello, einer der klügsten Lateinamerikaner seiner Zeit, Gefährte von Alexander von Humboldt auf dessen Reisen durch den Kontinent, unterrichtete ihn in Geographie und Literatur. Noch größeren Einfluss hatte Simón Rodríguez. Er machte den jungen Bolívar mit den Philosophen der damaligen Zeit vertraut. Beim englischen Staatstheoretiker Thomas Hobbes lernte er dessen Gesellschaftsverständnis einer aufgeklärten Monarchie, wonach alle Menschen bei der Überwindung von Furcht und Unsicherheit ihre Freiheitsrechte auf den Souverän übertragen, der sie voreinander schützt.
Der französische Aufklärer Claude Adrien Helvetius lehrte ihn, dass das Glück aller die Voraussetzung für das Glück des Einzelnen ist. Alle Menschen seien gleich, Unterschiede durch Besitz gelte es zu begrenzen.
Der Höhepunkt der Unterrichtungen war für seinen Lehrer das Werk von Jean-Jacques Rousseau, dem Wegbereiter der französischen Revolution. Hier wurde Bolívar vertraut mit dessen Grundauffassung, dass alle Menschen von Natur aus gut seien, aber dann durch die gesellschaftlichen Verhältnisse Neid, Missgunst und Niedertracht die Oberhand gewinnen würden. Daher sei es notwendig, einen Sozialvertrag zu schließen, der ein einvernehmliches Zusammenleben regele. Zudem lernte Bolívar über Rodríguez auch die Grundprinzipien der Republik, Gewaltenteilung und Volkssouveränität, kennen.
Als sein Lehrer wegen Widerstands gegen die spanische Kolonialverwaltung das Land verlassen musste, trat Bolívar als Kadett in die Militäranstalt Milicias de los Valles de Aragua ein. Nach zwei Jahren wurde er zum Unterleutnant befördert und zu weiterreichenden Studien nach Madrid geschickt. Dort wohnte er bei einem Amerikaner, der der Geliebte der Königin war und ihm auch Zugang zum Hof verschaffte. Im Anschluss an seine Studien unternahm der junge Venezolaner ausgedehnte Reisen durch Europa, beobachtete die Krönung Napoleons, traf Alexander von Humboldt, war an Königshöfen ein ebenso gern gesehener Gast wie in den literarischen Salons.
1807 kehrte Bolívar nach Venezuela zurück. Zur damaligen Zeit lebten dort weniger als eine Million Einwohner. 200 000 zählten sich zur weißen Oberschicht, 60 000 Sklaven schufteten am anderen Ende der sozialen Skala und dazwischen lebten die Mestizen und Mulatten von der Produktion von Kolonialwaren. Es gärte im Land. Der damals 57-jährige Francisco Miranda unternahm bereits konkrete Schritte zur Beseitigung der spanischen Fremdherrschaft. Er hatte sich aktiv an der französischen Revolution beteiligt und war dort zum General aufgestiegen. Anschließend reiste er quer durch Europa, um Waffen und Geld für den Unabhängigkeitskampf daheim zu sammeln. Schließlich konnte er ein kleines Expeditionsheer ausrüsten, das 1806 in See stach. Das Unternehmen scheiterte jedoch, ehe es begonnen hatte, viele starben, Miranda gelang die Flucht.
Sein Ziel war es, die Amerikaner des gesamten Kontinents zu vereinen. Eine föderative Regierung sollte ihren Sitz an seiner engsten Stelle nehmen: in Panama. Staatsreligion sollte der Katholizismus sein, aber ohne die Inquisition. Einen Namen für das neue Staatswesen hatte Miranda auch schon: El Império Americano. Er war der Erste, der den Ureinwohnern Amerikas eine zentrale Rolle zudachte. Zwei Inkas sollten die Regierung ernennen und führen, einer in Panama, der andere reisend, um sich den Problemen der Bewohner vor Ort zu widmen.
1810 gelang der Putsch gegen die spanische Kolonialverwaltung. Er wurde zum Signal einer kontinentalen Erhebung. Die Aufständischen übernahmen die Stadtverwaltung von Caracas. Doch angesichts der Übermacht des Gegners suchten sie nach Unterstützung durch eine Großmacht. Mit dieser Mission betrauten sie den damals 27-jährigen Simón Bolívar. Der sprach bei den Vereinigten Staaten vor, doch die beriefen sich auf ihre Neutralität. Auch England winkte ab, weil es mit Spanien gegen Napoleon verbündet war. In London traf er Francisco Miranda, der sich ihm auf der Heimreise anschloss und den Vorsitz der ersten Republik Venezuela von 1810 übernahm. Beide verfolgten die Idee einer kontinentalen Einigung.
Bolívar hatte ein festumrissenes Zukunftskonzept. Statt eines Königs sah Bolívar einen starken Präsidenten an der Spitze des Staates. Wie beim Vorbild der englischen Verfassung sollten feste Regeln das Zusammenleben organisieren. Zu gewährleisten seien bürgerliche Freiheiten, so die Freiheit der Rede, des Gewissens und der Presse. Mann und Frau seien gleich zu behandeln. Ein oberster Rat nach dem Vorbild der griechischen Antike sollte mit seinen Gesetzen einen verbindlichen Sittenkodex schaffen, an den sich jedermann zu halten hatte. Begabte junge Menschen sollten unabhängig von ihrer Herkunft gefördert werden, ein Institut hatte die Aufgabe, geeignete Schriften für die Volksaufklärung herauszugeben. Arbeit und Wissen sollten Leitmotive des neuen Staats sein. Soweit der Plan.
Doch der Kampf um die Unabhängigkeit zwang Bolívar, sich in der zweiten Hälfte seines Lebens in bewaffneten Auseinandersetzungen aufzureiben. Es zeigte sich, dass der kleine, schmächtige Mann das Zeug zu einem großen Feldherrn hatte. Er verfügte über schier unbegrenzte Energien, verkraftete Niederlagen, war körperlichen Strapazen gewachsen und schreckte auch vor Grausamkeiten nicht zurück. Mit den Jahren wuchsen seine Ruhmsucht und sein ausgeprägter Machtwille. Bei seinen Feldzügen legte er in Lateinamerika mehr an Kilometern zurück als die großen historischen Feldherrn Hannibal, Alexander der Große und Cäsar zusammen. Hunderttausende seiner Soldaten fanden den Tod, er überlebte, aber neben den Worten und der Schrift nahm das Schwert einen immer größeren Platz ein.
Die Besatzer kämpften mit allen Mitteln. Der spanische Oberbefehlshaber in Venezuela, General Juan Domingo de Monteverde y Rivas, ging rücksichtslos gegen die Zivilbevölkerung vor. Sein Befehl lautete, auch Frauen und Kinder nicht zu verschonen. Es folgte ein regelrechter Ausrottungskrieg, ein Drittel der Einwohner Venezuelas wurden entweder ermordet oder vertrieben. Nach der Rückeroberung von Caracas wurden nahezu alle verbliebenen Revolutionäre ermordet, auch Verwandte und Freunde Bolívars.
Die Aufständischen hatten sich zwar um äußere Unterstützung bemüht, die Gewinnung der Landbevölkerung im eigenen Land für ihre Sache jedoch vernachlässigt. Ein spanischer Schmuggler kam schließlich auf die simple Idee, für die Sache des Kolonialregimes die Llaneros – Reiter aus dem Tiefland – zu gewinnen. Aus dem Krieg zwischen Republikanern und Royalisten wurde ein Bürgerkrieg. Die Reiter zogen mordend und brennend durch die befreiten Städte. Bolívar reagierte 1813 mit dem Dekret »Guerra a Muerte« – Krieg bis zum Tod – und rief seinerseits den totalen Vernichtungskrieg aus. Seine Logik hatte er der jakobinischen Phase der französischen Revolution entlehnt: »Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.« (Ein Motto, das auch sein späterer Bewunderer Hugo Chávez übernahm.)
Konkret bedeutete es, dass alle Spanier, die sich nicht seinem Kampf angeschlossen hatten, ausnahmslos getötet würden. Dass dies keine leere Drohung war, machte er deutlich, als er nach der Eroberung der Hauptstadt am 6. August 1813 die zweite Republik ausrief und 800 Spanier als Geiseln nahm. Sie wurden bis auf den letzten Mann niedergemacht. Um Patronen zu sparen, erschlug oder henkte man sie. Doch nach kurzer Zeit waren die
Kolonialtruppen wieder zurück und Bolívar erneut auf der Flucht.
1816 kehrte er siegreich nach Caracas zurück, doch der neue spanische Monarch Ferdinand VII. wollte das Kolonialreich nicht aufgeben. Er schickte 110 000 Mann zur Verstärkung. Dennoch gelang es Bolívar, die Stadt Angostura einzunehmen und nunmehr die dritte Republik auszurufen. Um die spanische Überlegenheit auszugleichen, heuerte er Söldner in Europa an. Sie kamen aus England, Irland und aus Deutschland, vor allem aus dem Königreich Hannover und aus Hamburg. Einer von ihnen, Major Otto Braun, befehligte Bolívars Leibwache.
1824 fiel endlich die stärkste spanische Bastion in Lateinamerika, das Vizekönigreich Peru. Damit begann das Ende der 300-jährigen Herrschaft Spaniens. In der Schlacht von Ayacucho verlor der spanische Vizekönig, General José de la Serna e Hinojosa, sein letztes Gefecht. Er blieb auch durch einen prominenten Nachfahren im Gedächtnis, den wohl berühmtesten Lateinamerikaner aller Zeiten: Ernesto Guevara de la Serna – »Che« Guevara.
Simón Bolívar erlebte den schönsten Moment seines Lebens: Er, der Libertador, der Befreier, wurde zum Präsidenten mit umfassenden Vollmachten nicht nur seines Heimatlandes Venezuelas, sondern auch von Kolumbien, Ecuador, Peru und dem nach ihm benannten Bolivien ausgerufen. Doch das Glück währte nur kurz. Ausgerechnet in Venezuela begann der Zerfall des Staatenbundes. Bolívars Vizepräsident und Gegenspieler General Santander spaltete die Konföderation in zwei Lager.
Bolívar erlebte Jahre der Bitternis. Santander initiierte ein Attentat auf ihn, drängte den Präsidenten zur Abdankung. Es wurde einsam um ihn, und er verlor sein Vermögen. Resigniert stellte er fest: »Ich habe auf dem Meer gepflügt und im Sand gesät.« 1830 trat er seine letzte Reise an, von Bogotá ins europäische Exil, das er nicht mehr erreichte. Er starb am Ufer der kolumbianischen Karibikküste. In seinen letzten Stunden vertraute er einem Priester an: »Dieses Land wird unweigerlich in die Hände zügelloser Tyrannen fallen, die allen Farben und Rassen angehören.«
Nachdem Simón Bolívar in Caracas im Pantheon beigesetzt worden war, wuchs sein Ruhm Jahr für Jahr. Und mit ihm begann ein verhängnisvoller Personenkult, dem viele Staatslenker Lateinamerikas verfielen. Es bildete sich der Caudillo als spezifische Variante des lateinamerikanischen Diktators heraus. In Spanien wurden mit diesem Titel ursprünglich jene Heerführer ausgezeichnet, die die Iberische Halbinsel von den Arabern zurückeroberten. Nach Bolívar wurde daraus generell »der Anführer«. Er hatte in Lateinamerika einige spezielle Merkmale: Er war durchweg männlich (macho), autoritär, verkörperte eine starke Persönlichkeit mit Ausstrahlung, hatte einen großen Willen zur Macht, Mut und die Fähigkeit zur politischen und militärischen Leitung. Oft war sein Handeln gepaart mit Rücksichtslosigkeit und Brutalität. Er trat immer dann auf, wenn die zivilen Autoritäten die Ordnung nicht aufrechterhalten konnten, was gern auch als Vorwand benutzt wurde. Am Ende einer Phase des »Caudillismo« stellte sich zumeist heraus, dass die (militärischen) Führer das Land auch nicht besser regierten.
Der nachfolgende Kult um den Befreier wurde zum gesellschaftlichen Kitt, der Venezuela bis heute zusammenhält. Der mexikanische Autor Enrique Krauze schreibt:
»Egal ob amtlich, volkstümlich, künstlich oder spontan, ob klassisch, romantisch, nationalistisch, internationalistisch, militärisch, zivil, religiös, mythisch, venezolanisch, andin, iberoamerikanisch, panamerikanisch oder universell: Der Kult um Bolívar wurde zum Bindeglied zwischen den Venezolanern, zum Sakrament ihrer Gesellschaft.«
Die acht Jahrzehnte nach Bolívars Tod waren geprägt von der Herrschaft der Caudillos. Nicht wenige übten ihre Herrschaft unter Verweis auf die Traditionen von Simón Bolívar aus. Doch der entschiedenste Bewahrer des Erbes war General Juan Vicente Gómez. Vielleicht, weil er am 24. Juli 1857 geboren wurde, dem Geburtstag des Befreiers? Vermutlich hat er sich das Datum selbst zugeschrieben. Der Kreis schloss sich, als er auch noch am 17. Dezember 1935 starb, dem Todestag seines Idols! Anders als der Libertador, der durch Mumps in der Kindheit unfruchtbar geworden war, hinterließ Gómez 15 eheliche und 60 bis 70 uneheliche Kinder.
Der General siegte im vorerst letzten Bürgerkrieg Venezuelas 1903 gegen lokale Aufständische und rettete Cipriano Castro damit dessen Präsidentschaft. Der machte ihn zum Dank zum Vizepräsidenten. Doch als er sich in Paris wegen einer besonders hartnäckigen Syphilis behandeln ließ, übernahm General Gómez 1908 die Macht und verbot dem amtierenden Präsidenten die Rückkehr ins Land. Danach regierte er Venezuela 27 Jahre lang mit harter Hand. 1908 ernannte ihn der Kongress zum provisorischen Präsidenten, danach amtierte er von 1910 bis 1915, von 1915 bis 1922, dann von 1922 bis 1929 und schließlich von 1931 bis 1935.
War er nicht selbst im Präsidentenpalast, so zog er als Oberbefehlshaber die Fäden im Hintergrund. Wäre er nicht gestorben – er hätte weitergemacht. Verfassungsrechtliche Bedenken hatte er beizeiten aus dem Weg geräumt. Er ließ das Verbot der mehrfachen Wiederwahl aufheben, die Amtszeit des Präsidenten auf sieben Jahre verlängern und das Amt des Vizepräsidenten abschaffen, denn er wusste aus eigener Erfahrung, wozu man dieses Amt nutzen konnte. Die Verfassung wurde seinen jeweiligen Bedürfnissen angepasst: 1909, 1914, 1922, 1925, 1928 und 1931. Die reichte dann bis zu seinem Tod.
Der am längsten regierende Präsident Venezuelas, General Juan Vicente Gómez (1857 – 1935) Seine Partei waren die Streitkräfte. Er stärkte ihr Gewicht, indem er konsequent gegen die Milizen regionaler Caudillos vorging (zu denen auch der Urgroßvater von Hugo Chávez zählte), die Professionalisierung der Armee vorantrieb, die Militärakademie in Caracas schuf, die Wehrpflicht einführte, die Luftwaffe gründete und nach Kräften mit Flugplätzen im ganzen Land und einer eigenen Militärakademie förderte. Seine Macht sicherte er zusätzlich ab, indem er seine zahllosen Freunde und Verwandte in Regierungsämter brachte. Sie sorgten dafür, dass es ihr Wohltäter zu riesigem Reichtum brachte: Er wurde Venezuelas größter Grundbesitzer und kontrollierte auch die Viehwirtschaft des Landes.
Wer sich ihm in den Weg stellte, wurde eingesperrt, getötet oder beim Straßenbau mit härtester Arbeit umgebracht. Nur wenige Glückliche schafften es, außer Landes zu gehen. Durch die Zwangsarbeit der politischen Gefangenen konnten große Infrastrukturprojekte umgesetzt werden: die Autobahnen Caracas – La Guaira, Caracas – Petare und die Anden-Autobahn. Das offizielle Regierungsmotto lautete »Einheit, Frieden und Arbeit«. Der Volksmund machte daraus: »Einheit in den Gefängnissen, Frieden auf den Friedhöfen und Arbeit bei den Autobahnen.« Für Bildung hatte der General wenig übrig. Die Zentraluniversität von Caracas schloss er für 13 Jahre, und im Land nahm der Analphabetismus weiter zu.
Der General huldigte dem Bolívar-Kult wie kaum ein zweiter vor ihm. Schon in frühen Jahren machte er es sich zur Gewohnheit, sonntags seinen Leinenanzug anzuziehen, sich mit Dolch und Pistole zu gürten, den Sombrero aufzusetzen, um dem Befreier an einer Statue seine Reverenz zu erweisen. Später ordnete er als Präsident an, dass jeder, der an den Büsten vorbeiging, den Hut zu lüften und den Befreier zu grüßen habe.
Für den 100. Todestag Bolívars am 17. Dezember 1930 hatte sich der General eine besondere Überraschung ausgedacht: Er verkündete, dass Venezuela seine Auslandsschulden auf einen Schlag zurückzahlen werde. »Welche Ehrung unseres Befreiers, indem seine Kinder, Männer der Arbeit, ernsthaft und verantwortlich, ihn ehren, indem sie ihre Gläubiger bis auf den letzten Centavo auszahlen.« Er konnte dies mühelos bewerkstelligen, weil er über eine nicht mehr versiegende Einkommensquelle verfügte: das Erdöl.
Millionen Jahre hatte es unter der Erde gelegen. Schon vor der Eroberung durch Spanien war der dicke schwarze Brei am Ufer des Orinoco-Flusses als Heilmittel für diverse Krankheiten, zum Abdichten von Kanus sowie zur Beleuchtung genutzt worden. Auch die Spanier selbst nutzten das schwarze Öl, zuerst zum Waffenreinigen. Als Karl V. von Spanien (1500 ‒ 1558) an Gicht erkrankte, verlangte er, dass man ihm ein Fässchen des schwarzen Breis zur Linderung schicke. Das erste Ölunternehmen hatte 1878 ein Venezolaner gegründet. António Pulido nannte seine Firma La Nacional del Petróleo de Táchira. General Gómez vergab gleich zu Beginn seiner 27-jährigen Herrschaft 1909 die erste Konzession an den Engländer John Allen Tregelles, der The Venzuelan Oilfield Exploration Company gründete. Seine Konzession verkaufte er später an die Royal Dutch-Shell Oil.
1914 schoss das erste Öl aus den Bohrlöchern. Am 31. Juli 1914 – pünktlich zu Beginn des 1. Weltkriegs, schoss die erste schwarze Fontäne 135 Meter hoch aus einem Bohrloch am Ostufer des Maracaibo-Sees. Die Entdeckung weiterer großer Vorkommen am nordöstlichen Ufer drei Jahre später machte klar, dass hier große Ölreserven lagerten. Ab 1918 erreichte venezolanisches Öl Europa. Firmen aus aller Welt kamen, um Bohrgründe und Konzessionen zu erwerben. Die US-amerikanischen Firmen, die damals über die besten Erfahrungen im Ölgeschäft verfügten, entwickelten einen strategischen Plan zur Ausbeutung der Vorräte. Heute weiß man, dass das Land über die weltweit größten Vorkommen verfügt. Im Maracaibo-See gibt es bereits zahllose Bohrtürme, doch das weltweit größte zusammenhängende Vorkommen befindet sich am Nordufer des Orinoko-Flusses, es allein enthält deutlich mehr Öl als alle Vorkommen Saudi-Arabiens zusammen.
Die Erdölausbeutung kollidierte jedoch mit der herkömmlichen Rechtsprechung. Die spanische Krone hatte alle Bodenschätze zum Eigentum des Königs und Bolívar zu Nationaleigentum erklärt. Doch General Gómez kümmerten solche Hindernisse wenig: Er erklärte seinerseits Enteignungen zur Erdölförderung für rechtens, baute allerdings eine Klausel in die Konzessionsverträge ein, wonach die Vorkommen nur zur Hälfte ausgebeutet werden durften – die andere Hälfte galten als Nationalreserve. Dennoch waren vor allem die US-Unternehmen begeistert: Zuhause mussten sie mühsam Claim für Claim von gierigen Grundstücksbesitzern kaufen, denn dort galt das Prinzip, dass der Bodenbesitz auch alles umfasste, was unter der Erde lagerte. In Venezuela hatten sie es nur mit einem Partner zu tun: General Gómez.
Schnell veränderte sich die venezolanische Gesellschaft. Vor dem Erdöl war Venezuela arm, bedeutungslos, unterentwickelt und die Bevölkerung zu 85 Prozent in der Landwirtschaft tätig – zumeist, um sich selbst zu ernähren. Die Erdölindustrie zog nun immer mehr Menschen aus den tropischen Küstengebieten, den Llanos und den entlegenen Gegenden des Landes in die Städte und stadtnahen Gebiete. Der Ölboom führte zu einer Aufwertung der nationalen Währung und verteuerte damit die traditionellen Exportprodukte wie Kakao und Kaffee, was zu deren Niedergang führte und die Landbevölkerung zur Abwanderung in die Städte zwang.
1960 lebten bereits 60 Prozent der Venezolaner in den übervölkerten Städten wie Caracas, in ihrer Mehrheit in den Elendsvierteln. Die sprudelnden Einnahmen aus dem Erdöl kompensierten den Niedergang der Landwirtschaft, und auch die Folgen der Weltwirtschaftskrise von 1929 meisterte Venezuela weitgehend ohne Einbrüche. Das Land war inzwischen zum größten Erdölexporteur der Welt aufgestiegen und der zweitgrößte Produzent hinter den Vereinigten Staaten.
Caracas war die teuerste Stadt der Welt. US-Präsident Franklin D. Roosevelt wollte es zunächst nicht glauben, dass man hier das Zweieinhalbfache dessen brauchte, was ein vergleichbarer Lebensstandard in Washington erforderte. Das Außenministerium bestätigte ihm allerdings den unglaublichen Befund.
Doch während Caracas blinkte und glitzerte, verharrte die Landbevölkerung im Dunkel der Unterentwicklung. Die Analphabetenrate war so hoch wie nur noch in Haiti – 80 Prozent –, Tuberkulose und tropische Krankheiten grassierten und dezimierten einen Gutteil der ländlichen Bevölkerung, die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei 33 Jahren. Gesundheitsfürsorge, fließendes Wasser oder Elektrizität waren Fehlanzeige. Damit sind auch die Motive hinreichend beschrieben, die eine lang anhaltende Binnenwanderung in die Städte anfeuerten. 1960 lebten bereits 60 Prozent der Venezolaner in den übervölkerten Städten, in ihrer Mehrheit in den Elendsvierteln.
Noch vor dem Tod von General Gómez bildete sich bereits das künftige Problem in voller Blüte heraus: Anstehende notwendige Veränderungen blieben aus und die daraus erwachsenden Probleme wurden mit Petro-Dollars zugeschüttet. »Wir exportieren das Öl, der Rest wird importiert«, wurde zum verhängnisvollen Leitmotiv venezolanischer Wirtschaftspolitik.
Der Bolívar-Fan Gómez hatte sich in den 27 Jahren seiner Herrschaft zum Caudillo aller Caudillos aufgeschwungen und beherrschte das Land wie sein Eigentum. Wo notwendig, verbesserte er die Infrastruktur, um die Waren – vor allem aus seiner Produktion – zu den Kunden zu bringen. Er und seine Freunde und Familienangehörigen besaßen ein Drittel des Landes, kontrollierten die Lebensmittelproduktion, und am Ende seines Lebens war General Gómez einer der reichsten Männer ganz Lateinamerikas. Doch nur kurz nach seinem Tod 1935 wurde seine Habe konfisziert und zum Staatseigentum erklärt. Seine Politik allerdings kopierten nahezu sämtliche seiner Nachfolger. Der venezolanische Historiker Elías Pino Iturrieta schrieb 1985 in seinem Essay »Tötet Gómez«: »Alle fünf Jahre, mit jeder neuen Regierung, wird unser Leben erneut bestimmt von der Herrschaft eines Gómez-Erben.«
* * *
Schon Bolívar haderte mit den Möglichkeiten und Grenzen der Freiheit des Volkes als Souverän. »Nach meinem Konzept ist nur die Demokratie zur absoluten Freiheit fähig; aber wo ist die demokratische Regierung, die gleichzeitig Macht, Wohlstand und Kontinuität vereinigt?« Was hätte er zu einem Diktator gesagt, der das Land voranbrachte und prägte und gleichzeitig das Volk unterdrückte wie kein anderer?
Marcos Pérez Jiménez konnte für sich durchaus eine südamerikanische Identität in Anspruch nehmen: Die Schule besuchte er in Venezuela und Kolumbien, daran schloss sich die Militärakademie in Caracas sowie der Besuch verschiedener Militärschulen in Peru an. So absolvierte er von 1939 bis 1943 die Höhere Kriegsschule für Führung und Generalstabsarbeit von Chorillos im Bezirk Lima. Wie der Libertador war er klein und eher unscheinbar. Doch er war Jahrgangsbester der Militärakademie und genoss bei seinen Offizierskameraden hohes Ansehen. Aus dem Generalstab heraus organisierte er Gleichgesinnte, mit denen er die Unión Patriótica Militar gründete.
Die jungen Militärs und die mit ihnen verbündete sozialdemokratische Acción Democrática übernahmen im Oktober 1945 die Macht. Hauptmann Marcos Pérez Jiménez wurde neuer Verteidigungsminister, Rómulo Gallegos Präsident. Gallegos gewann die Wahl – und wurde ein Jahr später gestürzt.
Diktator Marcos Pérez Jiménez (1914 – 2001)
Im Putschisten-Triumvirat befand sich wieder Marcos Pérez Jiménez. 1952 übernahm er die ganze Macht. Es war die Hochkonjunktur der lateinamerikanischen Modell-Diktatoren: In Kuba war es General Fulgencio Batista, im benachbarten Santo Domingo herrschte Rafael Trujillo und in Nicaragua näherte sich Anastasio Somoza seinem 20-jährigen Jubiläum im Amt. Argentiniens Diktator Juan Domingo Perón fand in Venezuela ein kommodes Exil und Pérez Jiménez ließ es mit seiner Weigerung, ihn auszuliefern, sogar auf den Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Argentinien ankommen. Er berief eine Verfassunggebende Versammlung ein (auch heute noch ein probates Mittel), die ungeachtet aller Proteste gegen den Staatsstreich eine neue Verfassung verabschiedete. Anschließend ließ er alle politischen Verantwortungsträger neu wählen: Die Mitglieder des Senats, die Abgeordneten des Kongresses, alle Mitglieder der Länderparlamente, alle Gemeindevertreter, die Richter des Obersten Gerichts, des Kassationsgerichts sowie den Generalstaatsanwalt und den Präsidenten des Rechnungshofes. Als alle Posten in seinem Sinne neu besetzt waren, trat er sein Amt als Präsident an.
Gegen seine politischen Gegner – vor allem Linke und Kommunisten – ging er mit brutaler Härte vor. Sie wurden massenhaft verhaftet und in geheimen Lagern wie der berüchtigten Isla Guasina im Dschungel des Orinoco Flusses gefoltert. Die wichtigste Stütze des Regimes bildete die Nationale Sicherheitspolizei. Die Nationaluniversität in Caracas wurde – wieder einmal – geschlossen, Parteien und Gewerkschaften verboten und die Pressefreiheit eingeschränkt. Dies führte dazu, dass US-Präsident Dwight D. Eisenhower Pérez für seine Verdienste im Kampf gegen den Kommunismus 1955 die Verdienstmedaille in der höchsten Stufe eines Chief Commanders verlieh. Und das US-Nachrichtenmagazin TIME setzte sein Foto im Februar 1955 aufs Titelblatt.
Er genoss das Leben auf Partys mit Cocktails und der Begleitung von Cabaret-Sängerinnen und -Tänzerinnen. Sein größtes Vergnügen soll es gewesen sein, spätabends mit dem Motorroller an einem Privatstrand nackte Mädchen zu jagen. Auch bei seinen Reisen liebte es Pérez schnell. Dann setzte er sich mit seinem Mercedes Sportwagen an die Spitze des Regierungskonvois, fuhr mit 160 Stundenkilometern über die abgesperrte Strecke und stürzte so sein Gefolge in Schwierigkeiten, weil sie dem rasenden Diktator nicht mehr zu folgen vermochten.
Für all jene, die keine Angehörigen im Gefängnis hatten, die nicht zu den Gefolterten und Misshandelten gehörten, waren es Jahre des Fortschritts und der sichtbaren Zunahme des gesellschaftlichen Wohlstands. So kommt es, dass so mancher Venezolaner noch heute der schönen Zeit gedenkt und dazu wehmütig die Melodie des »Früher-war-alles-besser« summt. An die Spitze dieser Nostalgiker stellte sich – Überraschung – Hugo Chávez. Nicht nur, dass er den früheren Diktator aus dem Exil zu seinem Amtsantritt als Ehrengast einlud. In seiner eigenen Fernsehshow »Aló Presidente« sagte er am 25. April 2010 in der 355. Sendung: »Ich denke, dass General Pérez Jiménez der beste Präsident war, den Venezuela jemals gehabt hat.« (Es vervollständigt das Bild der demokratischen Auffassung von Chávez, dass er nach seiner Machtübernahme den Namen des 1958 demokratisch gewählten Präsidenten Rómulo Betancourt, eines hochangesehenen lateinamerikanischen Politikers, aus allen öffentlichen Straßen und Plätzen tilgen ließ.)
Es waren wohl eher die wirtschaftlichen Umstände nach dem Zweiten Weltkrieg, die dem ohnehin reichen Venezuela noch einmal eine Sonderkonjunktur bescherten. Der weltweite Wirtschaftsboom in der westlichen Welt ließ den Ölpreis in neue Höhen steigen. Geopolitische Krisen im Nahen und Mittleren Osten sorgten später für immer neue Rekorde: Die Verstaatlichung der Erdölindustrie in Iran, der daraufhin von der CIA angezettelte Putsch gegen die demokratisch gewählte Regierung von Mohammed Mossadegh und die Schließung des Suez-Kanals durch General Gamal Abdel Nasser 1956 führten dazu, dass in diesen Jahren so viele Petro-Dollars in die Kassen des venezolanischen Staates flossen, wie in keinem anderen Land zur damaligen Zeit. Das Auslandskapital fand in Venezuela traumhafte Bedingungen vor; die Investitionen verdreifachten sich in den Jahren der Herrschaft von Pérez Jiménez.
Die zu Stein gewordenen Zeichen aus der damaligen Zeit prägen die Hauptstadt bis heute. »Der Diktator Pérez Jiménez, der von großen Paraden im römischen Stil träumte, ließ die Stadt kreuz und quer mit Baggern abrasieren, um Straßen für seine Truppenaufmärsche zu bauen«, berichtete damals Marcel Niedergang, französischer Reporter des France-Soir aus Caracas. »Das Centro Bolívar, der Stolz der Diktatur Pérez Jiménez, ist zu einem Komplex aus Wolkenkratzern, Büros, Einkaufspassagen und Hochgaragen geworden. Es erdrückt mit seiner großspurigen Monumentalität und seiner Einförmigkeit die Reste der alten Stadt.« Pérez ließ einen zwei Kilometer hohen Berg durchstechen, der zwischen Caracas und der Hafenstadt La Guaira liegt. Statt einer 31 Kilometer langen Fahrt durch so viele Kurven, wie das Jahr Kalendertage hat, führt nun eine schnurgerade halb so lange Strecke vierspurig durch künstlich belüftete Tunnel.
Es wäre sicher jedem einigermaßen begabten Staatsmann gelungen, die Modernisierung mit den Mitteln voranzutreiben, die Pérez Jiménez in den 50er Jahren zur Verfügung hatte. Denn bei seiner Machtübernahme sprudelten die 9000 Erdölquellen ergiebiger als je zuvor. Noch immer war Caracas eine der teuersten Städte der Welt, lebte hier bereits jeder fünfte Venezolaner. Die Stadt hatte mehr Taxis als Chicago, und es kamen zwei Autos auf zehn Bewohner.
Schon vor seiner Machtübernahme verkündete Pérez Jiménez, Putschisten und Revolutionäre könnten nur dadurch bekämpft werden, dass man »ihnen die Fahnen stiehlt«. So besänftigte er die Militärs mit einem Leben in Luxus, und die Linken, die er noch nicht ins Gefängnis geworfen hatte, stach er mit einem Sozialprogramm aus, das nicht einmal sie selbst zu fordern gewagt hatten.
Mit öffentlichen Mitteln wurden drei Dutzend Elektrizitätswerke, mehr als 100 Wasserwerke, Schlacht- und Kühlhäuser, fast 700 Krankenhäuser, 250 Schulen, große Arbeitersiedlungen, Rathäuser und Verwaltungsgebäude errichtet. Das Straßennetz des Landes verdoppelte sich. Durch den Ausbau der sanitären und medizinischen Einrichtungen konnte die Malaria im Land so gut wie ausgerottet werden. Als vorbildlich galten die staatlichen Richtlinien für die Behandlung kranker Arbeiter und Angestellter. Die Arbeitgeber wurden verpflichtet, Kranken während ihrer Arbeitsunfähigkeit den vollen Lohn weiterzuzahlen. Die Behandlung im Krankenhaus erfolgte kostenlos.
* * *
Zum Erdöl gesellte sich in der Amtszeit von Pérez Jiménez (1952 – 1958) auch noch die Entdeckung einer riesigen Eisenerzlagerstätte, des Cerro Bolívar. Der Berg mit einem geschätzten Vorkommen von 500 Millionen Tonnen Erz am Unterlauf des Orinoco enthielt 63 Prozent reines Eisen – höher als das beste Vorkommen Europas in Schweden. Es konnte im Tagebau gefördert und über den Fluss verschifft werden. U.S. Steel und Bethlehem Steel machten den Orinoco bis Puerto Ordaz schiffbar, bauten Straßen, Eisenbahnen und Förderanlagen. In der Nähe entstand ein Stahlwerk, das seinen Strom aus der Wasserkraft des Caroni-Flusses bezog. Ferner wurden Kohlengruben erschlossen, in die verarbeitende Industrie investiert und eigene Ölverarbeitungsanlagen wie Raffinerien und die Petrochemie errichtet. Autostadt Caracas in den 50er Jahren: mehr Taxis als in Chicago. Der Diktator war sich seiner Beliebtheit am Ende doch nicht mehr sicher und ersetzte die anstehenden Wahlen 1957 durch eine Volksabstimmung darüber, ob er weitermachen solle. Zwei Stunden nach Schließung der Wohllokale stand auch schon das Ergebnis fest (Weltrekord in der Stimmenauszählung zur damaligen computerlosen Zeit): 85 Prozent wollten ihn angeblich fünf weitere Jahre im Amt sehen. Doch die Sympathien waren wohl doch nicht so groß, denn in der Folgezeit nahmen die Umsturzversuche und Volksaufstände spürbar zu. Anfang 1958 setzte er sich mit seiner Frau und den vier Töchtern nach Miami ab. Sein Vermögen hatte er – nach den Erfahrungen aus der Enteignung von General Gómez bereits zuvor auf Auslandskonten versteckt. Nach dem Sturz der Diktatur gelangte mit Rómulo Betancourt 1959 ein Zivilist in freien und geheimen Wahlen ohne Einflussnahme des Militärs ins Präsidentenamt.
Betancourt war – wie Simón Bolívar – ein Politiker von kontinentalem Format, mit Beziehungen und Freundschaften in vielen lateinamerikanischen Ländern. Er war schon in jungen Jahren gegen die Diktatur von General Gómez aufgestanden, hatte illegal im Land gelebt, bis er ins Exil nach Costa Rica fliehen musste. Dort wurde er 1931 Mitbegründer der Kommunistischen Partei und arbeite aktiv in der Politik, bis er 1935 in Chile einen neuen Zufluchtsort fand. Nach den Erfahrungen mit dem Stalinismus wandte er sich vom Kommunismus ab und gründete 1941 die sozialdemokratische Acción Democrática (AD), eine Partei, die bis heute besteht, übernahm 1945 nach dem von ihm mitorganisierten Staatsstreich vorübergehend die Präsidentschaft der Provisorischen Revolutionären Regierung und amtierte bis 1948. Doch in der Zeit der nachfolgenden Militärherrschaft übersiedelte Betancourt 1950 mit seiner Familie nach Kuba. Dort lernte er wichtige Politiker kennen, die nach der Revolution 1959 in höchste Staatsämter gelangten: den ersten bürgerlichen Präsidenten Manuel Urrutia, der nur sechs Monate amtieren durfte, seinen kommunistischen Nachfolger Osvaldo Dorticos, der bis zu seinem Selbstmord 1976 im Amt blieb und Blas Roca, den Generalsekretär der Kommunistischen Partei (die Castros Guerrilla-Kampf nicht unterstützte) und späteren Parlamentspräsidenten Kubas.
Betancourt wurde den Herrschenden in Caracas so gefährlich, dass sie 1951 in Havanna versuchten, ihn mit einer Giftspritze zu ermorden. Der Staatsstreich von General Bastista beendete erneut sein sicher geglaubtes Exil. Er ging nach Costa Rica, ehe er sich in Puerto Rico und später in den USA niederließ. Bereits 1931 hatte er sein politisches Grundgerüst, den Plan de Barranquilla, niedergeschrieben: Kampf gegen die Herrschaft des Militärs, Sicherung demokratischer Freiheiten, Enteignung des Besitzes von Diktatoren, eine Alphabetisierungskampagne und die Errichtung einer gerechten Gesellschaft unter Einbeziehung aller dafür bereiten Kräfte. Und als er 1945 erstmals an die Macht kam, begann er diese Ziele auch umzusetzen.
In seiner Regierungserklärung zur zweiten Amtszeit vom 13. Februar 1959 verkündete Betancourt, dass seine Regierung künftig keine Beziehungen mehr zu Regierungen unterhalten werde, die auf nicht-demokratischen Wegen an die Macht gekommen waren. »Diejenigen Regimes, die die Menschenrechte nicht respektieren, die die Freiheit ihrer Bürger mit Füßen treten und eine Tyrannei mit Hilfe einer totalitären Politik errichten, sollten mit einem rigorosen cordon sanitaire isoliert und aus der Internationalen Gemeinschaft ausgeschlossen werden.« Diese fortan »Betancourt-Doktrin« genannte Politik führte zum Abbruch der diplomatischen Beziehungen mit Spanien, der Dominikanischen Republik, Kuba, Argentinien, Peru, Ecuador, Guatemala, Honduras und Haiti.
Betancourt nahm großzügig die Verfolgten aus Diktaturen auf und gewährte ihnen politisches Asyl. Er wurde ein unermüdlicher Verfechter demokratischer Grundwerte und setzte in seiner Präsidentschaft vor allem auf den dauerhaften Erhalt der parlamentarischen Ordnung. Er brachte die Vertreter der wichtigsten Parteien zusammen, um gemeinsam den Schutz der gerade erst errungenen demokratischen Rechte zu sichern. Der damals vereinbarte Pacto de Puntofijo sollte vier Jahrzehnte halten. Konkret verabredeten die Acción Democrática von Betancourt, die christdemokratische COPEI und die Liberale Unión Republicana Democrática drei Grundsätze:
- Verteidigung der Verfassung und strikte Respektierung der Ergebnisse derWahlen;
- Bildung von Koalitionsregierungen der nationalen Einheit;
- gemeinsame Regierungsprogramme mit den vordringlichsten Zielen vor Wahlen.
Es war das erste Mal in der Geschichte des Landes, dass man eine Koalition als Regierungsform vereinbarte. Doch der Pakt hatte einen Schönheitsfehler: Er bedeutete faktisch den Ausschluss der Kommunisten von künftigen Regierungen. Dabei war es gerade ihre Partei gewesen, die besonders aktiv gegen die Diktatur gekämpft hatte.
Ungeachtet dessen setzte nach Betancourts Regierungsantritt erst einmal eine spürbare Kapitalflucht ein, die Devisenreserven sanken und die Auslandsverschuldung, die schon in den Jahren der letzten Diktatur wieder kräftig zugenommen hatte, nahm beängstigende Ausmaße an. Die ausländischen Ölkonzerne stoppten ihre Investitionen, und schon 1960 war die demokratische Regierung gezwungen, den Devisenverkehr zu kontrollieren, um Spekulationen mit der Landeswährung vorzubeugen.
Betancourt brachte die Lage auf einen kurzen Nenner:
»Unsere Probleme wurden uns von den Diktaturen hinterlassen. Es sind mehr oder weniger die gleichen Probleme der anderen Länder Südamerikas: eine Bevölkerung, die mit übermäßigem Tempo wächst, eine schlechte Verteilung des Bodenbesitzes, eine ungenügende industrielle Entwicklung, ein sehr schwacher Markt, eine übertriebene Konzentration auf die Städte zum Nachteil des Landes, das anormal unterbevölkert ist.«
Ein besonders delikates Feld war das Erdöl. Für den neuen Ölminister Pérez Alfonzo war es das reine Teufelszeug«, denn er ahnte voraus: »In zehn oder zwanzig Jahren werden wir sehen, dass uns das Öl ruinieren wird.« Er war besonders gefordert, weil die USA Importrestriktionen für venezolanisches Öl verhängt hatten, um der Rezession im eigenen Land zu begegnen. Pérez Alfonzo versuchte gar nicht erst, an diesem Zustand etwas zu ändern, sondern nahm stattdessen Geheimverhandlungen mit Saudi-Arabien, Kuwait, Iran und Irak auf. Er schlug vor, staatliche Ölgesellschaften zu schaffen, die Gewinnverteilung auf 60 zu 40 Prozent zugunsten des Staates zu verändern und geheime Preisabsprachen zu etablieren. 1960 unterzeichneten diese Staaten die Gründungsurkunde der OPEC.
Seinen größten Erfolg erlebte Betancourt 1963 zum Ende seiner Amtszeit: Er trat zu keiner Wiederwahl an und übergab die Macht an seinen, ebenfalls aus freien und geheimen Wahlen hervorgegangenen Nachfolger Raúl Leoni von der AD. Das hatte es in den 133 Jahren der Existenz als Republik noch nie gegeben.
Damit hatte sich der Puntofijo-Pakt bewährt. Doch zugleich zeigten sich schon die Schattenseiten dieser paktierten Demokratie. Aus dem politischen Kartell mit ursprünglich drei Beteiligten wurde bald ein Duopol aus der sozialdemokratischen AD und der christdemokratischen COPEI. Wie vereinbart, gingen die beiden Parteien außerordentlich pfleglich miteinander um, was auch darin zum Ausdruck kam, dass nicht eine Administration die vorangegangene ablöste, sondern beide – dank der Petro-Dollars – außerordentlich kreativ daran gingen, die Abgelösten in neugeschaffenen Institutionen unterzubringen. Man kann sich vorstellen, dass nur zwei, drei Machtwechsel reichten, bis sich endgültig ein undurchdringlicher politischer Filz gebildet hatte.
Im Dezember 1973 fanden wieder Wahlen statt, und mittlerweile zweifelte kaum jemand noch, dass sie wie geplant über die Bühne gehen würden. Ein Dutzend Kandidaten stellte sich zur Wahl, es siegte der 49-jährige Carlos Andrés Pérez – kurz CAP genannt – von der sozialdemokratischen Acción Democrática. Der frühere Büroleiter von Präsident Betancourt hatte sich Hilfe bei US-Wahlkampfstrategen geholt und den Sieg nicht zuletzt durch eine teure Fernsehkampagne errungen.
Sein Wahlprogramm enthielt Lohnerhöhungen auf breiter Front, die Stärkung der daniederliegenden heimischen Landwirtschaft und der mittelständischen Industrie. Vor allem versprach er ein »Gran Venezuela« – ein großes Venezuela – sowie den Anschluss an die »Erste Welt«. Er siegte mit einer halben Million Stimmen vor dem Kandidaten der COPEI, seine AD holte 28 der 49 Senatorensitze und 102 Abgeordnetenmandate. So eindeutig hatte vor ihm noch niemand gewonnen.
Als er im März des Folgejahres den Präsidentenpalast übernahm, war wieder einmal das Konjunkturbarometer auf ein Hoch gewechselt. Im Nahen Osten hatten sich die arabischen Nachbarn aufgemacht, um die Schmach des Sechs-Tage-Krieges von 1967 zu tilgen und waren mit dreitausend Panzern der ägyptischen und syrischen Armee, unterstützt von Luftwaffenverbänden beider Länder zum Angriff auf Israel übergegangen. Nach zwei Wochen war der Kampf beendet, die Israelis hatten die Angreifer zurückgeschlagen und am 22. Oktober verkündeten die Vereinten Nationen einen Waffenstillstand.
Die Unterlegenen suchten nun, den Krieg mit anderen Mitteln fortzusetzen und verhängten über die USA, die Israel unterstützt hatten, und Europa, das die arabische Seite nicht unterstützt hatte, einen Erdölboykott. Er dauerte fünf Monate und hob den Weltmarktpreis für Rohöl in bis dahin unbekannte Höhen. Venezuela erzielte 1974 Mehreinnahmen von 260 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In »normalen« Staaten waren derartige Sprünge der Staatseinnahmen unbekannt. Das Finanzministerium verdreifachte auf einen Schlag seine Einnahmen und das weckte Begehrlichkeiten.
Der ewige Mahner, Warner und Gründer der OPEC, Pérez Alfonzo, schlug vor, die Produktion zu drosseln und diese riesigen Gewinnsprünge dauerhaft und nachhaltig zu verwenden. Er machte sich Sorgen darum, dass Venezuela in einen wirtschaftlichen Notstand wegen zu viel Geld geriet. Es gab nämlich keine Strukturen, die diesen Geldfluss in produktive Bahnen lenkten, keine Planungsvorarbeiten, und über allem schwebte zudem die Angst, dass sich angesichts der Geldmassen die Preise für Waren und Dienstleistungen verteuerten und alles in einer großen Inflation münden würde.
Der Präsident, der zugleich Vizepräsident der Sozialistischen Internationale war, begann, den neuen Reichtum mit vollen Händen auszugeben. In den ersten 100 Tagen der Regierung jagte ein Dekret von Andrés Pérez das nächste. 193 exekutive Anweisungen wurden in dieser Zeit erlassen. Die Löhne und Gehälter wurden kräftig angehoben, es wurde viel Geld in die bestehenden Sozialsysteme gepumpt. Die Hauptaufgabe der Regierung war es in jener Zeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Massenentlassungen wurden per Dekret verboten. Weil man keine Arbeit einfach aus dem Boden stampfen konnte, gab Präsident Andrés Pérez kurzerhand die Weisung, dass alle Aufzüge im Land ab sofort durch einen Liftboy zu bedienen seien und alle öffentlichen Toiletten eine »Klofrau« einzustellen hätten.
Der zweimalige Präsident Carlos Andrés Pérez (1922 – 2010) Zum 1. Januar 1975 wurde die Eisen- und Stahlindustrie nationalisiert. Die Arbeiter und Angestellten setzten sofort zum Sturm auf die Staatskasse an und riefen drei Wochen später den Generalstreik aus, um ihren Teil vom Dollarregen abzubekommen. Mit Erfolg: Die Regierung erhöhte die Löhne, erweiterte die Sozialleistungen bei Arbeitsunfähigkeit, Teilinvalidität, im Todesfall sowie die Altersrente. Als Sahnebonbon gab es ein staatliches Geschenk für jedes Brautpaar. Doch diese Maßnahmen wurden noch nicht als ausreichend angesehen, vier Wochen später folgte der nächste Generalstreik.
Die Verfassung von 1961 räumte dem Präsidenten eine außerordentliche Machtfülle ein: Er ernannte alle Gouverneure, alle Leiter staatlicher Unternehmen und war Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Das reichte Carlos Andrés Pérez nicht aus. Er ließ sich zudem vom Parlament alle Vollmachten bei der Mittelverwendung geben. Das 1974 verabschiedete Gesetz gab ihm freie Hand bei der Verwaltung des Staatshaushalts. Das Parlament gab damit eine seiner Kernaufgaben, die Kontrolle des Haushalts der Regierung, bereitwillig preis. Zusätzlich angefeuert wurde der Geldfluss durch die freigiebige Vergabe von langfristigen Krediten zu günstigen Zinsen. Die Zahl der Anleihen stieg massiv an. Nach einem Jahr war eingetreten, was zu befürchten war: Die Preise stiegen, die Inflation verdoppelte sich und überstieg die Höhe der Zinsen für Bankeinlagen. Die Regierung steuerte mit neuen Maßnahmen gegen den zunehmenden Unmut in der Bevölkerung an: Preiskontrollen, Subventionen für Lebensmittel und Medikamente, kostenlose medizinische Behandlung und Krankenhausaufenthalte, Preissenkungen von sozialen Dienstleistungen aller Art für Bezieher kleinerer Einkommen, Steigerung der Löhne und Gehälter.
Auch sich selbst bedachte die Regierung: 1977 wurden auf einen Schlag sieben neue Ministerien geschaffen: Stadtentwicklung, Umwelt, erneuerbare Naturressourcen, Information, Tourismus, Transport und Kommunikation. Die Präsidialkanzlei erhielt den Status eines Ministeriums. Doch ein Jahr später war schon wieder Schluss mit dem Stellenaufwuchs: Angesichts schwindender Einnahmen wurde ein Einstellungsstopp verkündet. Für die enorm erstarkten Mittelschichten und die kleine Oberklasse begann die Zeit der Verschwendung, in der das Land zum viel zitierten »Saudi-Venezuela« mutierte. Sie gaben das Geld mit vollen Händen aus. Das Pro-Kopf-Einkommen erreichte das Niveau des Wunderwirtschaftslandes Westdeutschland. Aber 1978 war der Rausch auch schon wieder vorbei und der Import von 500 Luxusgütern wurde verboten.
Die neuen Reichen in Venezuela wussten, wie ein gehobener Lebensstandard aussieht. Sie hatten ihn bei den ausländischen Ölexperten beobachtet, die hochbezahlt in eigenen Siedlungen ihr gewohntes westliches Leben führten. Diese waren zwar mit Zäunen umgeben und von sogenannten guachimanes (die spanische Verballhornung des englischen watchman) gesichert. Hier gab es aber spezielle Läden mit Importgütern, Tennisplätze, Baseballfelder, Swimmingpools, Kinos, Golf-Anlagen und modern eingerichtete Krankenstationen und Schulen. In diesen Siedlungen traf man sich beim Baseball, im Country-Club oder bei Schönheitswettbewerben.
Der Erdölmarkt veränderte sich derweil. In Mexiko war man auf riesige Vorkommen gestoßen, 1975 floss das erste Öl aus der Nordsee durch die Pipelines, und in Alaska stieg die Produktion auf zwei Millionen Barrel pro Tag. Hinzu kam, dass die neuen Förderer keine OPEC-Mitglieder und demzufolge nicht an deren Preisabsprachen gebunden waren. In dieser Zeit verkündete der venezolanische Präsident 1975 die Verstaatlichung der Erdölförderung. Fünf Jahre zuvor hatte der Staat bereits die Kontrolle über die Vermarktung des Öls übernommen. Die Reaktion auf diese radikal anmutende Enteignung von ausländischem Besitz blieb moderat, weil die Ölmultis seit Jahren nicht mehr in ihre Felder investiert hatten und viele auch ihren Erschöpfungsgrad erreicht hatten, neue Bohrungen aber immer teurer wurden.
Wieder einmal erfüllten sich die düsteren Prognosen des Öl-Weisen Pérez Alfonzo: Am Ende der fünfjährigen Amtsperiode des Präsidenten hatten sich die Beschäftigtenzahlen im staatlichen Sektor verdoppelt, war ein kaum noch zu durchschauendes Netz staatlicher Betriebe und Institutionen entstanden, die vor allem eins produzierten: ein unbeherrschbares Chaos. Milliarden Dollar verschwanden, ohne dass jemand genau sagen konnte, wo sie geblieben waren. Viel Geld wurde schlicht für Luxus und nicht enden wollende Importe ausgegeben. Der Nebeneffekt war, dass die einheimische Lebensmittelindustrie erneut geschwächt wurde.
In diesen Jahren des ungebremsten Ausgebens wurde deutlich, dass auch sehr, sehr viel Geld nicht ausreicht, um alle Wünsche zu befriedigen. Schon 1977 überstiegen die Staatsausgaben die Einnahmen in einem Umfang von 8,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Entwicklungstempo wurde scharf abgebremst durch das Fehlen qualifizierter Arbeitskräfte. Die Inbetriebnahme Hunderter neuer Betriebe war ohne eine begleitende Erhöhung der Energieproduktion geschehen und führte zu Stromabschaltungen. Die nationalen Unternehmen produzierten nicht in ausreichender Qualität, sodass zusätzlich zu den Waren, die nur in den USA und Europa zu bekommen waren, auch Dinge des täglichen Bedarfs im Ausland eingekauft wurden, was die einheimische Industrie zusätzlich unter Druck setzte und die negative Handelsbilanz weiter verschärfte. Die Steuerung der Wirtschaft glitt der Regierung zusehends aus den Händen.
Die staatliche Telefongesellschaft CANTV fror ihre Preise beim Stand von 1969 ein, die staatliche Agentur für Landwirtschaft kaufte Lebensmittel im Ausland und setzte sie zu staatlich verordneten niedrigeren Preisen im Inland wieder ab; viele staatliche Unternehmen nahmen Kredite auf, ohne dass dies irgendwo vermerkt wurde.
Ursprünglich sollten die Überschüsse aus den Erdöleinnahmen in einen staatlichen »Venezolanischen Investmentfonds« fließen, um die Abhängigkeit des Landes von diesem Monoprodukt zu verringern. Angedacht war, die Hälfte der Überschusseinnahmen an den Fonds zu überweisen. Doch dieses Geld kam dort so gut wie nie an, und die Mittel, die sich dort befanden, dienten letztlich dem Staatspräsidenten als unkontrollierbarer Verfügungsfonds. (Etwa zur gleichen Zeit legte Norwegen seinen Staatsfonds auf – er ist weltweit der größte geworden und hat heute ein Volumen von über einer Billion Dollar.)
Es wurde in der damaligen Wahrnehmung auch nicht etwa als ein persönliches Fehlverhalten von Carlos Andrés Pérez gewertet, auch sein Nachfolger Luis Herrera Campins, den der Rückgang der Weltmarktpreise für Rohöl mit voller Wucht traf, plünderte die Kasse des staatlichen Ölkonzerns PDVSA weiter und leitete die Rücklagen von sechs Milliarden Dollar in die Staatskasse um. Die Korruption wurde in den 80er Jahren zu einer kaum noch beherrschbaren Erscheinung des Alltags. Bei der PDVSA, mittlerweile Lateinamerikas größtem Unternehmen, versagten die Kontrollinstanzen reihenweise. Einer ihrer Generaldirektoren gründete ein Unternehmen, das genau die Pumpen und Ventile produzierte, die das Staatsunternehmen benötigte – und zu Monopolpreisen ankaufte. Ein
anderer Generaldirektor beteiligte sich an einem privatisierten Unternehmen, das die Bücher der PDVSA kontrollieren sollte. Überall wurde die Hand aufgehalten, jeder versuchte, seinen Schnitt zu machen. Die »paktierte Demokratie« der beiden großen Parteien führte immer mehr dazu, dass sich die Eliten nur noch scheinbar an der Macht abwechselten und sich zwischen den Wahlen die Taschen gegenseitig füllten.
Am 18. Februar 1983 war die Fiesta vorüber. An diesem Tag – seither als der »schwarze Freitag« im kollektiven Gedächtnis verankert – platzte die Blase und der seit 20 Jahren feste Wechselkurs von 4,30 Bolívares zum Dollar wurde aufgegeben. Die Abwertung war dringend geboten, um weitere Schäden von der Volkswirtschaft des Erdöllandes abzuwenden. In den Wochen und Monaten zuvor hatten vermögende Venezolaner das Geld säckeweise ins Ausland geschafft. Damals schätzte man, dass täglich fast eine Milliarde der überbewerteten Landeswährung in Dollar umgetauscht und auf US-Banken deponiert wurde.
Präsident Herrera Campins oblag es, seinen konsumfreudigen Landsleuten die Lust am Luxus zu vermiesen, indem er – erstmalig in der Geschichte – die freie Konvertierbarkeit des Bolívars einschränkte und ein Zuteilungssystem für Devisen einführte. Dieses System – RECADI genannt – wurde jedoch erneut zum Füllhorn für Schwarzmarktgeschäfte aller Art.
Staatliche Beamte wurden bestochen, um Luftimporte zu bestätigen und mit diesem Zertifikat verbilligt Dollars eintauschen zu können. Der Zweck, notwendige Importe zu subventionieren, wurde nicht erreicht. Dafür wollten die Vorwürfe nicht mehr verstummen, dass der Präsident Freunden und Familienangehörigen zuvor einen Wink hatte zukommen lassen, ihre Gelder in Sicherheit zu bringen.
Herrera Campins verlor den Rückhalt in der Bevölkerung, und auch die USA gingen auf Distanz. Das führte zu einigen außenpolitischen Volten. So war Venezuela eines der wenigen Länder, die Argentiniens Anspruch auf die Falkland-Inseln gegenüber Großbritannien unterstützten. Zum Zeichen ihrer Solidarität untersagte die Regierung, dass bei offiziellen Anlässen schottischer Whisky ausgeschenkt wurde.
Jaime Lusinchi, Präsident von 1984 bis 1989, rückte das in eine Schieflage geratene Verhältnis zu den USA wieder gerade und kaufte sich 1986 in die US-Tankstellenkette CITGO ein. Damit erhielt Venezuela Zugang zur Direktvermarktung seines Rohöls auf seinem Hauptabnehmermarkt, den Vereinigten Staaten, und erhielt eigene Verarbeitungskapazitäten. Doch die Raffinerieanlagen mussten erst einmal aufwändig umgebaut werden, denn sie waren nicht für das schwere venezolanische Rohöl ausgelegt.
In seiner Amtsführung setzte Lusinchi die Art seiner Vorgänger fort und konnte weder Korruption noch Vetternwirtschaft überwinden. Seine kolumbianische Geliebte und persönliche Sekretärin Blanca Ibáñez wurde zum Symbol des Nepotismus im Miraflores-Palast. Sie soll damals über die Ernennung von Ministern ebenso entschieden haben, wie über die Beförderung hoher Offiziere und Generäle. Sie unterzeichnete freihändig Verträge und Erlasse, ohne dafür autorisiert zu sein. Lusinchi kümmerten die Vorwürfe nicht im Mindesten, er verlieh ihr sogar noch den »Orden des Befreiers«, die höchste zivile Auszeichnung des Landes.
Ende 1988 wurden wieder Wahlen abgehalten, und Carlos Andrés Pérez trat noch einmal an, wobei er gezielt an die »guten Zeiten« seiner ersten Präsidentschaft erinnerte. Die Mittelschichten glaubten noch immer, dass der Ölboom langfristig ihren Lebensstandard erhalten würde. Aber auch Arbeiter und Angestellte hofften auf eine Wiederholung der schönen Jahre mit Subventionen, niedrigen Preisen für die täglichen Dienstleistungen und Zugang zu Bildung mit dem Ziel des sozialen Aufstiegs. Carlos Andrés Pérez siegte.
Zur Amtseinführung erschienen zahlreiche Staatsmänner, unter ihnen auch Fidel Castro. Eine Woche später war er wieder da, diesmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Marinestützpunkt La Orchila, einer nördlich von Caracas gelegenen Insel. Hier unterbreitete er Andrés Pérez den Vorschlag, dass Venezuela die Erdölversorgung der sozialistischen Insel übernehme und die Sowjetunion dafür die Lieferverpflichtungen Venezuelas in Europa besorge. Das Einsparpotential beim Transport läge auf der Hand. Doch das Geschäft kam nicht zustande, und Castro reiste wieder einmal verärgert aus Venezuela ab.
Am 16. Februar 1989 stellte Andrés Pérez sein Regierungsprogramm vor, mit dem er der schwierigen Wirtschaftslage begegnen wollte. Seine Wähler fielen vor Schreck fast vom Stuhl: ein Katalog von Maßnahmen, wie sie im Regelfall der Internationale Währungsfonds (IWF) in Not geratenen Ländern zwangsverordnete. Eine Schockwelle jagte die nächste: Verdopplung der Benzinpreise und damit der Preise für den öffentlichen Nahverkehr, Beendigung der Subventionen für Nahrungsmittel, drastische Preissteigerungen für Strom, Wasser, Gas, Telefon. Freigabe des Wechselkurses des Bolívars. Der paquetazo (das Maßnahmenpaket) schlug sofort auf die Inflation durch, die um 40 Prozent anstieg und damit die Bevölkerung noch einmal belastete.
Elf Tage später brach der Protest los: Am Nuevo Circo, dem zentralen Busbahnhof, begannen die Demonstrationen, angeführt von Studenten. Binnen kurzer Zeit sperrten sie Straßen und Schnellstraßen. In den angrenzenden Vierteln wurden Barrikaden errichtet, Autoreifen in Brand gesteckt. Hilflos musste die städtische Polizei mitansehen, wie Geschäfte geplündert wurden. Aus dem neuerrichteten Shopping Center wurden ganze Wohnungseinrichtungen heraus getragen. Der Caracazo hatte begonnen.
Damit hatte die Unzufriedenheit mit den korrupten Clientelverhältnissen seit dem Pacto de Puntofijo ihren ersten Höhepunkt erreicht. Der Präsident suspendierte die verfassungsmäßigen Rechte und schickte die Armee in die Unruheviertel. Es gab Berichte, dass die Soldaten bis zu 4000 Menschen ermordeten und in Massengräbern verscharrten. Dieser ungeheuerliche Angriff auf die Bürgerrechte sorgte vorübergehend für Ruhe. Es wurde totenstill. Der Aufstand in Caracas 1989 forderte beinahe 4000 Tote.
* * *
Doch damit war die wirtschaftliche Rosskur noch lange nicht beendet. Viele staatlich subventionierte Betriebe mussten aufgeben, und Massenentlassungen waren an der Tagesordnung. Die Inflation wuchs Woche um Woche weiter an. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen dreistellig, die Reallöhne sanken unter das Niveau von 1955. Die Armut grassierte, die Gewaltkriminalität stieg explosionsartig an.
Sicherheitsfirmen schossen wie Pilze aus dem Boden, die Villen der Oberschicht wurden mit hohen Mauern umgeben, ein guachiman mit einer Pumpgun in den Händen galt bald als Standardmaßnahme. Auf den Straßen im Zentrum von Caracas war niemand mehr sicher. »Express Kidnapping« ging um: Die entführte Person wurde solange festgehalten, bis ihr Konto mit der Kreditkarte am Geldautomaten »abgemolken« war.
Am frühen Morgen des 4. Februar 1992 schreckten Schüsse aus automatischen Waffen die Bewohner von Caracas auf. Sie konnten nicht von den üblichen Überfällen stammen. 43 Jahre lang war Venezuela von Staatsstreichen verschont geblieben. Diesmal hatten jüngere Offiziere der Panzertruppen und Fallschirmjäger die Initiative ergriffen, um Präsident Andrés Pérez festzunehmen, ihn vor ein Militärtribunal zu stellen und wegen Korruption anzuklagen. Die Gruppe nannte sich Movimiento Bolivariano Revolucionário 200 (MBR 200) und wollte das Werk Simón Bolívars zu Ende bringen, eine provisorische Regierung aus Militärs und unbelasteten Zivilisten bilden und eine Verfassunggebende Versammlung einberufen. An der Spitze der Putschisten stand Oberstleutnant Hugo
Chávez.
Mit dem Kommunismus war Chávez als 13-Jähriger in Berührung gekommen. Er war mit seiner Großmutter und seinem Bruder Adán aus der Kleinstadt Sabanetas im Westen des Landes in die Provinzhauptstadt Barinas gezogen, wo er neue Freunde aus der Nachbarschaft kennenlernte: Vladimir (nach Lenin) und Federico (nach Friedrich Engels) Ruiz Guevara. Er erhielt aufgrund seiner Ungelenkigkeit beim Fußballspielen den Namen »Tribilín« – die spanische Version für die Comic-Figur Goofy. Der Vater seiner neuen Freunde, José Esteban Ruiz Guevara, war ein überzeugter Kommunist, der die drei Jungs zunächst mit Büchern von Rousseau oder Macchiavelli versorgte. Er unterwies sie auch in venezolanischer Geschichte. Später folgte die Lektüre von Karl Marx und anderen Theoretikern. Einmal geweckt, ließ der Lesehunger des jungen Chávez nicht mehr nach. Er las sich systematisch durch die Bibliothek seines Mentors.
Das erste Vorbild des jungen Chávez war – Chávez – Nestor Chávez, genannt »El Latigo« (Die Peitsche), ein venezolanischer Baseballspieler, der in seinen besten Zeiten bei den San Francisco Giants spielte. Er kam 1969 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Wie der spätere Präsident selbst berichtete, besuchte er als 17-Jähriger die Grabstätte seines Idols, um ihn um Vergebung zu bitten, weil er nun seine Vorbilder hatte: Ernesto »Che« Guevara und Fidel Castro. Doch dabei blieb es zunächst. Er nahm an keiner politischen Aktion teil und trat keiner der außerordentlich zahlreichen kommunistischen Organisationen des Landes bei.
Eines Tages hielt ein Offizier von der Militärakademie einen Vortrag an seiner Schule. Dies war der Impuls, der Chávez veranlasste, sich in der Militärakademie in Caracas zu bewerben. Als er eintrat, hatte er in seinem leichten Gepäck ein Buch: Das »Bolivianische Tagebuch« von Ernesto »Che« Guevara.
Der junge Hugo Chávez Frías (1954 – 2013)
Präsident Rafael Caldera von der christdemokratischen COPEI hatte zum Zwecke der Professionalisierung der Streitkräfte eingeführt, dass die künftigen Offiziere nicht nur eine militärische Ausbildung, sondern auch ein ziviles Studium abschließen mussten. Chávez’ Jahrgang an der Militärakademie war der erste mit einem dualen Diplom. Er studierte also neben Militärstrategie auch die Politik und Geschichte seines Landes. 1975 erhielt er aus den Händen des Staatspräsidenten Carlos Andrés Peréz den Offizierssäbel. Sein erster Einsatz brachte ihn als Chef einer Funkeinheit zurück in seine Heimat. Dort begann er, eine Radioshow aufzubauen und Artikel für Zeitungen zu schreiben. Trotzdem langweilte er sich auf dem Posten. Einem Freund vertraute er an: »Noch vor dem Jahr 2000 werde ich General sein, und ich werde etwas Großes für mein Land geleistet haben.«
Während sein älterer Bruder Adán für die linksradikale MIR kämpfte, bekam Chávez Kontakt zum Ex-Guerrillero Douglas Bravo, der sich von den Kommunisten abgewandt hatte. 1981 bis 1984 unterrichtete er an der Militärakademie Venezuelas Militärgeschichte und hinterließ mit seinen antiimperialistischen Ideen bei Chávez einen tiefen Eindruck. Dann wurde Bravo verdächtigt, illegale politische Aktivitäten zu unterstützen, und an die entfernte Grenze zu Kolumbien strafversetzt. Doch dort betrieb er umso energischer die Schaffung eines Netzwerks vertrauenswürdiger Offiziere, mit denen er die verdeckt agierenden »Bolivarianischen Revolutionären Streitkräfte« bildete. Mehrere Jahre bereiteten sie sich für die entscheidende Aktion vor. Chávez war derweil zum Major befördert und 1987 nach Caracas in den Präsidentenpalast Miraflores abkommandiert worden, wo er Adjutant des Chefs des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates wurde. Später übernahm er als Oberstleutnant den Geheimdienststab eines Fallschirmjägerregiments.
Als es dann im Februar 1992 zum Putsch kam, scheiterte dieser nicht zuletzt an der dilettantischen Vorbereitung. Die Einheiten, die den Präsidentenpalast besetzen sollten, kannten den Weg nicht und verirrten sich. Die Panzer, die dort endlich Stellung bezogen, verfügten über keine Munition, weil die sich auf einem Lastwagen befand, der in einem Vorort steckengeblieben war. Die Ansprache von Hugo Chávez ans Volk war zuvor auf Band aufgenommen worden und sollte von einem Fernsehsender ausgestrahlt werden – doch es war das falsche Videoformat.
Putsch gegen die Regierung am 4. Februar 1992
Präsident Andrés Pérez kam gerade aus dem Schweizerischen Davos zurück und konnte auf dem Weg zu seiner Residenz einer Verhaftung entgehen. Er ließ sich zum Präsidentenpalast Miraflores fahren und nutzte dort einen unterirdischen Tunnel. Dann hielt er eine Fernsehansprache, in der er die übrigen Streitkräfte zu Hilfe rief. Die Aufständischen blieben isoliert und wurden von regulären Einheiten eingekreist und verhaftet. Hugo Chávez gab unter der Bedingung auf, dass er sich noch einmal über das Fernsehen an sein Volk wenden könne. Es wurde ihm gewährt. Er räumte seine Niederlage ein – »por ahora« – für dieses Mal.
Während Chávez im Gefängnis saß, startete nur neun Monate später der nächste Putschversuch unter Führung des Konteradmirals Hernán Grüber Odremán. Er hatte seine militärische Laufbahn im Kampf gegen die kommunistische Guerrilla begonnen und war zum Generalinspekteur der Marine aufgestiegen. Der Staatsstreich scheiterte aber ebenso, und er wurde zu den anderen Aufrührern ins Gefängnis San Carlos in Caracas gesteckt. Nach der späteren Regierungsübernahme durch Hugo Chávez beförderte dieser ihn zum Gouverneur der Hauptstadt. Nach schweren Korruptionsvorwürfen zog er sich dann aus der Politik zurück.
Carlos Andrés Pérez überstand diese zwei Staatsstreichversuche, doch aus dem Amt kippte ihn der Generalstaatsanwalt der Republik 1993 mit einer Anklage wegen Korruption. Während des Prozesses kam heraus, dass er 17 Millionen Dollar aus der Staatskasse abgezweigt hatte – zur Unterstützung der nicaraguanischen Präsidentin Violeta Barrios de Chamorro. Bei den vorgezogenen Neuwahlen siegte Ex-Präsident Rafael Caldera (1969 – 1974), der seine Partei COPEI verlassen hatte und ein breites Wahlbündnis anführte. Die Convergencia bekam 31 Prozent der Stimmen, die Altparteien AD und COPEI landeten abgeschlagen bei 20 Prozent. Das war Ausdruck dafür, dass das drei Jahrzehnte alte System der Parteien des Pacto de Puntofijo sein Ende erreicht hatte.
Doch auch der neuen Regierung war kein Glück beschieden. Die Erdölpreise verharrten auf niedrigem Niveau, und wenige Monate nach Übernahme der Regierung, in der Ex-Guerrillero Teodoro Petkoff das wirtschaftlich entscheidende Planungsministerium übernommen hatte, brach eine Bankenkrise aus. Die Sparer hatten das Vertrauen in die nationalen Finanzinstitute verloren und wollten an ihre Einlagen. Dadurch geriet die Banco Latino in eine Schieflage. Kurz darauf ging das zweitgrößte Bankhaus Venezuelas pleite. Daraufhin wurden auch andere Banken in den Abgrund gerissen. 60 Prozent aller Einlagen gingen verloren. Die Kapitalflucht nahm gefährliche Dimensionen an, die Inflation stieg rapide, Kredite wurden so gut wie nicht mehr gewährt, und wenn, dann mit Zinsforderungen von 60 Prozent. Die Armut grassierte im ganzen Land, und Hoffnungslosigkeit machte sich breit.
Die Zeit war reif für einen politischen Neuanfang.
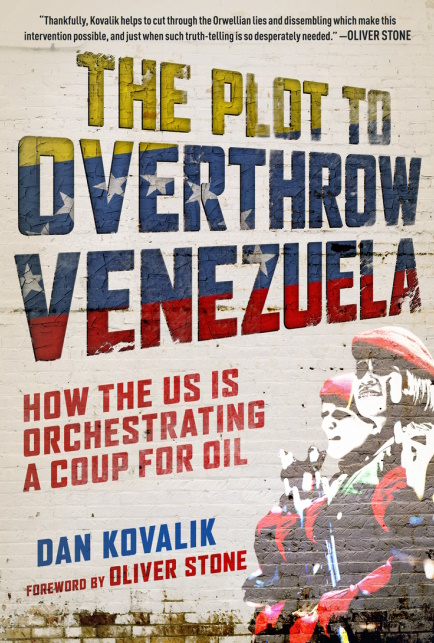
Impressum