Frustration und Selbstsabotage In diesem Buch werden wir die tief verwurzelte Verbindung zwischen Narzissmus, Selbstsabotage und persönlicher Veränderung erkunden. Wir werden uns mit den Mechanismen und Mustern befassen, die uns daranhindern, unsere wahren Fähigkeiten zu erkennen und auszuleben, und damit, wie wir diese Muster durchbrechen können, um eine positive Transformation zu erreichen.
Frustration und Selbstsabotage
Ich kenne dieses Anbranden einer irrationalen, narzisstischen Erwartung aus meiner Arbeit mit Klienten in der Psychotherapie. Gewissermaßen repräsentiere ich die äußere Realität in Gestalt des Therapeuten, bin von der Realität gespeist und stelle mich, so abstinent und neutral wie möglich, der eigensinnigen, subjektiven Wahrnehmung des narzisstisch motivierten Klienten. Lasse seine Vorstellungen von einer Realität (das Realitätsmodell) auch gegen mich anbranden, beobachte, wie diese Vorstellungen mein Gegenüber innerlich beherrschen und es darin gefangen halten. Ein Teufelskreis von Überzeugungen, Erwartungen, Gefühlen und Befürchtungen. Auch kann ich erkennen, wie die Gedanken über das eigene Denken, also auf der Metaebene, im Klienten selbst durch eine starke gedankliche Einengung auf den Teufelskreis unreflektiert sind und die Selbstüberwachung des eigenen Denkens mit versagt. Narzissmus strandet.
So wie Jenny (ich nannte sie plötzlich innerlich so) in meiner Therapiestunde mit ihrem Narzissmus gestrandet war. Sie litt daran, denn die gelebte Rolle der äußerlich erfolgreichen Geschäftsfrau reichte nicht mehr aus, ihre innere Sehnsucht nach Liebe zu stillen. Eine so große innere Leere, die weder ihr
Partner noch andere auffüllen konnten. Ich konnte dieses Liebesloch auch nicht füllen.
Die äußere Arbeit war getan. Jenny war erfolgreich und »hatte alles«. Aber die innere Arbeit musste nun erfolgen. Denn ihr Strahlen kam nicht von innen. Innen beherrschten sie nur tyrannische Gedanken in teuflischen Spiralen: Sie verglich sich mit anderen, bewertete und (ver)urteilte. Ihre Vorstellungen der Realität (Realitätsmodell) passten nicht mehr zur tatsächlichen Wirklichkeit. Es waren unreife und zugleich idealisierte Vorstellungen über eine Realität wie sie sein sollte. Wie sie jedoch nicht war und nie werden würde. Denn Realität ist zu komplex, und auf dem ehrenhaften Weg zum Ideal muss man scheitern. Denn das Ideal ist nie erreichbar. Ihr blieb nur, schön zu scheitern. Jenny war schon lange unterwegs auf dem Weg zu ihren Idealen, und nun häufte sich ihr Scheitern, so kurz vor dem erträumten Ziel, die perfekte Unternehmerin und die perfekte Liebende zu sein, was sie frustrierte.
Dann, wenn die eigenen Erwartungen nicht mehr übereinstimmen mit der geteilten Realität der anderen Mitmenschen, beginnt das Leiden. So auch bei Jenny. Denn dann befinden sich narzisstische Menschen außerhalb dieser geteilten Realität. Sie suchen wie Jenny das Besondere und haben keinen Blick mehr für das Normale. Das Gewöhnliche.
Diese Menschen sind nicht psychisch krank, sie sind nicht psychotisch. Sie haben nicht vollständig den Kontakt zur Realität verloren. Aber sie haben eine gewisse Tendenz entwickelt, den Kontakt zur Realität aufzugeben. Sie denken verstärkt an Ideale, die nicht erreichbar sind. Und sie halten mittels bestimmter Gedanken, die irgendwie passend für sie sind, narzisstisch eben, an diesen Idealen fest. Ihre größte Befürchtung ist, diese erwartungsvollen Gedanken zu verlieren. Ihre größte Angst ist, Ideale zu verpassen und deswegen dann auch nichts mehr für andere zu bedeuten. Völlig wertlos für andere zu sein, weil sie nichts mehr darstellen.
Ich habe nichts gegen Ideale, ich finde sie sogar erstrebenswert, denn sie orientieren mich, wie ein Fixstern am Himmel. Aber ich muss sie nicht erreichen müssen und mich ihnen nicht selbstbestrafend unterwerfen, wenn ich mal vom Weg abkomme. Denn je näher ich dem Ideal komme, desto schmerzhafter wird es.
Diesen Schmerz der Anstrengung und Belastung, den spürte Jenny schon länger. Sie konnte nicht loslassen. Sie wollte auch darin perfekt sein. In ihrer Pflicht, sich ihren Idealen zu unterwerfen, um damit ihre Schuldgefühle vor dem eigenen Versagen zu neutralisieren. Um sich nicht eingestehen zu müssen, eine ganz normale Person, ein Mensch zu sein, der auch Sachen nicht hinbekommt. Um ihre Angst vor dem normalen Leben zu vermeiden, verpflichtete sie sich, dem Ideal zu folgen. Dieses Ideal, in der Modeszene außergewöhnlich gut, erfolgreich und raffiniert zu sein, erkannte sie nur über die Reaktion ihres beruflichen Umfeldes. Sie selbst hatte die Grenze zur Perfektion nur darin gefunden, Fehler zu finden, sich selbst zu kritisieren und das Optimale zu verfolgen.
Jenny existierte für sich nur dadurch bewusst, was sie in anderen über sich selbst als optimalen Zustand in einer gedachten Realität wahrnahm. Als wären diese gespiegelten Narzissmen identitätsstiftend, und sie aufzugeben, käme einem Verrat an sich selbst gleich. Mit der Gefahr, ihr Realitätsmodell und damit die »Realität« vollständig zu zerstören. Das durfte aus Jennys Perspektive niemals eintreten. Also hält man daran fest und verteidigt diese eigenen abwegigen Gedanken, aus Angst, die Kontrolle über sich und das eigene Leben zu verlieren, was unweigerlich zu (weiteren) Konflikten mit anderen Menschen
führt.
Gedanken und Vorstellungen wie die von Jenny sollten also durch mich nur eine Erklärung und Einordnung bekommen. Aber ich sollte und durfte sie niemals auflösen.
Ich musste sie gleich in der ersten Stunde, die für Jenny voller Hoffnung war, frustrieren. Die Frage »Wer bin ich?« sollte ich ihr beantworten. (Aber das wusste ich in dieser ersten Stunde noch nicht.) Ich konnte ihr diese Antwort nie ernsthaft geben. In dieser Frustration dachte sie kurz über sich nach. Wurde ruhiger. Spürte in sich hinein. Da empfand sie ein wenig diesen inneren Verrat, Gedanken aufzugeben, die sie so lange, über Jahrzehnte, gedacht und nach denen sie gelebt hatte. Der Narzissmus setzte sich fort, obschon er unter der Frustration kurz zurückgegangen war.
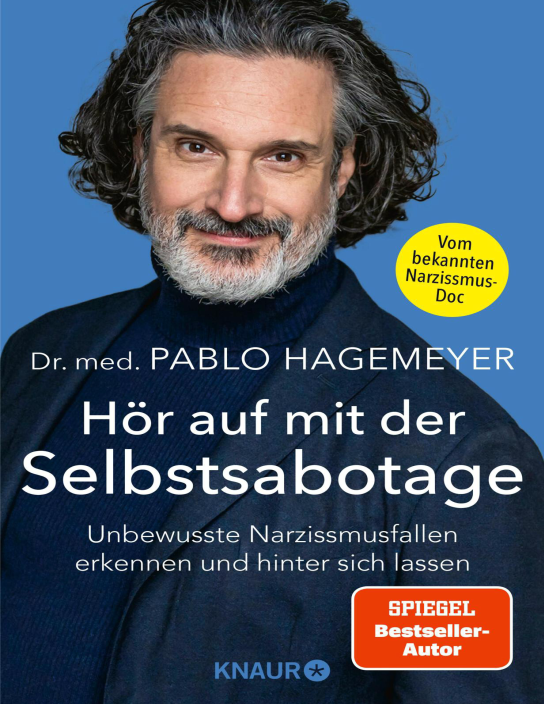
Impressum