Alltagsnarzissmus In diesem Buch werden wir die tief verwurzelte Verbindung zwischen Narzissmus, Selbstsabotage und persönlicher Veränderung erkunden. Wir werden uns mit den Mechanismen und Mustern befassen, die uns daranhindern, unsere wahren Fähigkeiten zu erkennen und auszuleben, und damit, wie wir diese Muster durchbrechen können, um eine positive Transformation zu erreichen.
Alltagsnarzissmus
Um diese hartnäckigen gedanklichen Einstellungen in unseren Gehirnen aufzuspüren, betrachte ich gerne Situationen, in denen Menschen durch ihre Überzeugungen anecken, frustriert sind und scheitern. Diese selbstsabotierenden Phänomene werden erst sichtbar, wenn sich Menschen an Hindernissen, Schwellen und Widerständen emotional aufreiben und nicht weiterkommen. Dann kann Selbstsabotage sogar hilfreich sein, weist auf das Problem hin und bahnt einen Weg zur Lösung. (9)
Jenny wollte wissen, wie das ginge. Ich sah sie an und sagte, na so, wie hier gerade. Erkennen, was einen selbst sabotiert. Beobachten, aushalten und sich auf sich selbst zurückfallen lassen. Und aus einem selbst werden dann die Kräfte geweckt, neue Quellen der Kraft gefunden, die das Problem auflösen. Da könne man auch sicher sein, sagte ich. Bei sich selbst?, fragte Jenny und sah mich mit ihren großen Augen an. Da wolle sie ja gern sein, aber wie dort landen, wenn da nichts sei? Früher, dachte ich, da hatte ich einen Fußball und einen Stock, als Kind, so mit sieben oder acht. Das hat mir so viel Selbstbewusstsein geliefert, weil ich »Der mit dem Ball und dem Stock« war. Damit konnte ich nicht versagen.
Den Fußball schoss ich gegen Wände oder mit Freunden hin und her. Und an meinem Stock schnitzte ich herum und rammte ihn irgendwo in den Boden. Ich war »Der mit dem Ball und dem Stock«. Ich hatte eine Identität, die meinen Selbstwert bildete. Komme, was wolle.
Ich fragte Jenny, ob sie nicht auch so etwas gehabt hatte. Ball und Stock. Ich hatte Ken und Barbie, antwortete Jenny. Die habe sie gekleidet und hübsch gemacht. Die hatten aber nie etwas miteinander. Barbie war dann irgendwann kaputt, ohne Haare und ohne Kopf. Und Ken war verschwunden. Verloren gegangen.
Wenn Sorgen und Befürchtungen aufgrund einer äußerlichen Veränderung, eines Zufalls oder einer Begegnung hochschießen und so das eigene Bewältigungsbemühen zwar aktivieren, aber ins Versagen führen, macht das Angst. Das sind Momente, in denen Menschen aus ihren Routinen geweckt, aus dem Alltag und aus der Komfortzone aufgeschreckt werden und in denen sie reagieren – aber weiter scheitern. Sie scheitern eben, weil sie Angst bekommen. Weil sie deprimiert werden durch so viel Frustration. Sie haben dadurch kaum noch Kraft. Darum schleppen sie sich mit ihrem Alltagsnarzissmus zur Arbeit und durch die Tage. Und ihre Angst, dass alles keinen Sinn ergibt, ringt sie nieder. Eine Angst, die besonders Frauen wie Jenny sehr gut kennen. Die Angst vor dem Scheitern. (10) Wofür das alles?
Für mich sind diese Hallo-wach-Momente erkenntnisreich, aber meist nur Randbereiche der menschlichen Psyche. Denn sie entziehen sich dem Alltag, geschehen beiläufig und werden rasch wieder ins Vergessen verdrängt. Diese psychische Abwehr (11) (ungewünschte Wahrnehmungen werden unbewusst vom Bewusstsein ferngehalten) erfolgt durch sogenannte defensive kognitive Strategien (12) , auf diese Weise wird Unangenehmes wie die Angst vor dem Scheitern neutralisiert. Besonders vulnerable Narzissten erleben Angst als wenig hilfreich und meist als reine Negativerfahrung. Um Dinge zu glauben, die der Realität nicht entsprechen, wird sich abgeschottet, verdreht, ins Gegenteil gekehrt, ignoriert, geleugnet, in einen anderen Kontext gesetzt und gerechtfertigt. Das ist zunächst normal, jedoch deutlich verschärft, wenn man narzisstisch motiviert denkt. Denn im kleinen, privaten Scheitern und im großen, beruflichen Scheitern steckt nicht viel Rühmliches aus der narzisstischen Perspektive. Der Alltag ist mit intensiv eingeübten Routinen
und Wiederholungen aufgefüllt, die nur der narzisstisch motivierten Selbstverteidigung dienen, um die Angst vor dem Scheitern zu vermeiden. Ein robuster, grandioser Alltagsnarzissmus kann diese Angst vordergründig gut bewältigen. Aber wenn man tiefer bohrt und zum sensiblen, verletzlichen Kern des Narzissmus kommt, erkennt man, dass der nicht die notwendige innere Arbeit erledigt, wenn es darum geht, die Angst vor dem Scheitern zu bearbeiten. Er meidet sie.
Wie bei Jenny, die keine Vorstellung davon hatte, was sie für eine innere Arbeit leisten müsste, um ihre Frustration, ihre Ängste und Depression loszuwerden. Stattdessen wurde sie von wertenden, urteilenden inneren Gedanken beschossen, als sie sich ihrem Selbst näherte. Sie solle sich einfach um ihren Alltagsnarzissmus kümmern, arbeitete ich mit Jenny heraus. Und darum, dass alles so weiterläuft wie bisher. Alltagsnarzissmus bezieht sich auf gewöhnliche narzisstische Verhaltensweisen und nicht auf einen pathologischen Narzissmus. Positive Selbstbezogenheit, ihre gelungene, charmante elbstinszenierung, ihr anspornendes Wettbewerbsdenken – das waren hilfreiche, narzisstische Verhaltensweisen für Jenny. Gedanken an den Erfolg der nächsten Kollektion eine optimistische narzisstische Ausbreitung ihrer Person. Sie wurde zu ihrer Kollektion. Daran war nichts Falsches. Diese Gedanken, das waren gesunde Gedanken ihres Alltagsnarzissmus. Die können, wenn sie zu viel werden, durchaus auch einen sabotierenden Charakter haben, etwa indem das erschaffene Image die eigene Selbstentfaltung für ein authentisches Leben blockiert. Wenn das Image der Modeschöpferin unpassend ist und verdeckt, was sich noch entfalten möchte.
Aber meistens ist der Alltag eben doch ein Ort der Ordnung, und die Situationen, in denen sich das spezifisch abweichende Denken in aller Deutlichkeit zeigt, sind nur kleine, eingestreute Momente, die dem Wachbewusstsein wie sanfte Abweichungen vorkommen müssen: eine aus dem Unbewussten aufblitzende narzisstische Meinung hier. Eine sich kurz zeigende, innere narzisstische Haltung da. Für die Psyche sind diese kleinen Momente der Klarheit nur Abweichungen, merkwürdige Singularitäten, fremd, neu, und damit immer auch kleine irritierende Ausnahmesituationen – ich, narzisstisch? Nein –, die schnell wieder vergessen sind und ins Unbewusste abtauchen, als wäre diese abwegige Meinung, dieser merkwürdige, narzisstische Gedanke nie da gewesen. Aber dennoch wirkt er irgendwie hinein in die eigene Lebensrealität.
Jennys Alltagsnarzissmus war instabil geworden, hatte etwas Angst bekommen, weil da etwas in ihr war, das er nicht kannte. Etwas Großes und Bedrohliches. Etwas – ich versuchte das dramatisierend zu beschreiben –, das belastet war. Sie sei doch gut, dachte sie, sagte sie, genug, so, wie sie sei. Aber ihr gefiele etwas nicht an ihr, oder?, fragte ich nach. Womit rettete sich ihr Alltagsnarzissmus, um eben nicht diese notwendige innere Arbeit leisten zu müssen?
Ich habe diese Momente, in denen ich mir sehr gut gefalle, sagte Jenny und lächelte. Da sprach wieder ihr Alltagsnarzissmus, und der half, wenn es mal nicht so gut lief.
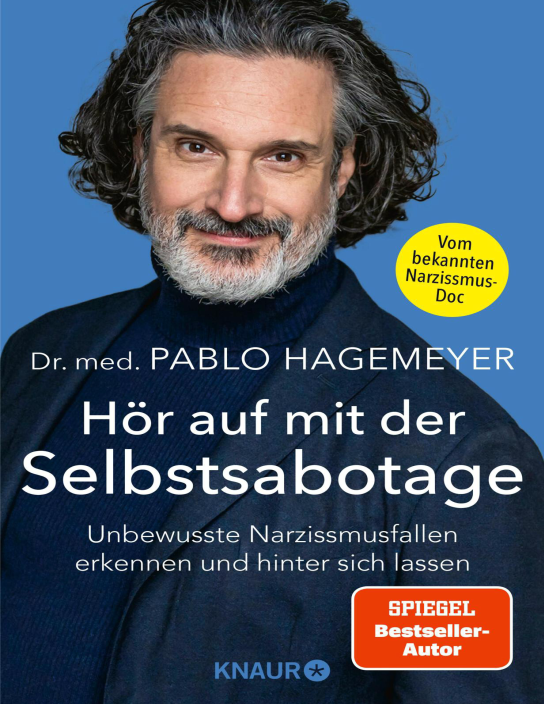
Impressum