Der Streit um den schönen Schein
Der Streit um den schönen Schein
Angst und Hoffnungslosigkeit sind Gefühle, die krank machen. Vertrauen und Hoffnung haben heilende Wirkung. Dieses alte Wissen, das Grete Flachs Heilkunst bestimmte, wird von modernen Forschern schon lange bestätigt.
Aber hat die Medizin diese verborgene Kraft wirklich akzeptiert? Bei genauer Betrachtung sind Vertrauen und Hoffnung keineswegs ungreifbare Gefühle, Bewegungen der Seele, auf die wir keinen Einfluss haben. Sie hängen vielmehr davon ab, was wir selbst für möglich halten, was wir uns und anderen zugestehen und was wir zu tun bereit sind. Bisweilen wird uns die innere Gewissheit, wieder gesund zu werden, in Träumen geschenkt, oder wir spüren ohne jeden Zweifel, dass eine Heilung geschehen kann. Oft aber müssen wir uns dieser Möglichkeit bewusst zuwenden, uns selbst überzeugen, dass wir wieder in Harmonie kommen werden.
Die Gewissheit aber kann niemand erzwingen. Weil der Zweifel in jedem Menschen wohnt, oft auch eine unter der Oberfläche schwelende Angst vor schweren Schicksalsschlägen, sind wir auf die Hilfe anderer angewiesen. Im Gespräch mit ihnen kann sich Angst auflösen und neue Hoffnung entwickeln. Wir sind eher bereit, dem Urteil anderer Menschen und ihrer Gewissheit zu trauen als uns selbst. Je größer die Kompetenz unseres Gegenüber erscheint, umso mehr sind wir bereit, uns in das Netz des Vertrauens fallen zu lassen, das er aufspannt. Und so kann es geschehen, dass wir wie kleine Kinder aus den Worten ihrer Eltern im Gespräch mit einem Arzt oder Heiler Kraft gewinnen, die so unmittelbar wirkt wie eine Arznei. Die Information allein, dass uns eine bestimmte Behandlung, ein Ritual, ein Pilgerfahrt, ein neues Medikament heilen werde, kann gesund machen.
Diese Macht des Bewusstseins ist in der Schulmedizin wohl bekannt, aber sie spielt in der Ausbildung der Ärzte wie in der täglichen Praxis nur eine untergeordnete Rolle. Den Forschern in den Labors der Pharmaunternehmen erscheint der Einfluss des Geistes sogar als störender Faktor. Denn er bringt ein großes Moment der Unwägbarkeit in die Medizin, weil sich bei jeder Behandlung, bei jedem Erfolg oder Misserfolg die Frage stellt, welchen Anteil der Geist eines Patienten hat und welchen das Medikament.
In der wissenschaftlichen Medizin kommt es aber darauf an, jederzeit verlässliche Aussagen machen zu können und so jedem Arzt die Möglichkeit zu geben, mit einer bestimmten Dosierung eines bekannten Medikamentes stets den gleichen Effekt zu erzielen. Subjektive Faktoren, gar die verborgene Fähigkeit, mit der ganzen Persönlichkeit heilend zu wirken, entziehen der Medizin den sicheren Boden und rücken sie in die Richtung einer Kunst, die mehr mit Begabung als mitWissen zu tun haben könnte. Das aber ist nicht leicht zu akzeptieren, denn die Schulmedizin lebt noch immer in der Hoffnung, das Regelwerk des Körpers eines Tages vollständig verstehen zu können. Sie sucht das Objektive, jedem Fachmann Zugängliche, möchte gleichsam die Mechanik derHeilung verstehen, die Zahnräder entdecken, die das Uhrwerk des Körpers in Bewegung halten, um Schäden sicher und dauerhaft reparieren zu können. Mit dieser Haltunggelingen ihr große Erfolge, aber weil die Vorstellung eines verborgenen Räderwerks den Blick auf die Rolle des Geistes verstellt, stößt sie auch immer wieder an ihre Grenzen.
Wenn Medizin wieder zur Kunst würde, was sie in ferner Vergangenheit einmal war, kehrte etwas Irrationales und in jedem Fall, bei aller Kreativität, äußerst Subjektives zurück. Eine verschwindend kleine Zahl wirklicher Künstler stünde dann einer unübersehbaren Zahl von Kunsthandwerkern gegenüber.
Die Hoffnung der konventionellen Medizin aber richtet sich auf den Fortschritt in der Forschung: Irgendwann, wenn die Geheimnisse der Heilung vollständig als biologische Regelkreise enthüllt worden seien, würden die unscharfen Vorstellungen und Verfahren der »Außenseiter« zwangsläufig verschwinden. Im Vorgriff auf diese Zukunft fordern viele Mediziner, nur dem Messbaren, jederzeit von jedem Forscher Nachvollziehbaren, das Siegel der Anerkennung zu verleihen. Diese Haltung gleicht der eines Schatzsuchers, der aus dem grauen Fels einer Mine einen großen Brocken Gestein schlägt, in dem Gold funkelt, aber auch Quarz und viele andere edle Mineralien. Weil er pures Gold möchte und nichts sonst, lässt er diesen Stein liegen und folgt einer anderen Spur, die ihm ein kleiner Stein weist, der ihm rein genug erscheint, denn er hasst Verbindungen, die nicht eindeutig sind. Und so verspielt er vielleicht die Aussicht auf einen gewaltigen Schatz.
Die Goldsucher in der Medizinforschung verlangen tatsächlich reine Ergebnisse in ihren Studien. Und so nennen sie ihr wissenschaftliches Credo den »Goldstandard«, eine Methode, die alle Ebenen jenseits des Materiellen ausschließen möchte. Die »randomisierte Doppel-Blind-Studie« ist ein Versuchsaufbau, dem sich alle Behandlungsmethoden zu unterwerfen haben, wenn sie wissenschaftlich anerkannt werden wollen: Wenn ein neues Medikament getestet wird, dann wird eine Gruppe von Versuchspersonen mit vergleichbaren Symptomen ausgewählt. Ohne dass die Patienten und ihre behandelnden Ärzte es wissen, wird diese Gruppe in zwei Untergruppen aufgeteilt, und zwar zufällig, randomisiert, wie der Fachbegriff lautet.
Die erste Untergruppe erhält das neue Medikament mit seinen chemischen oder biologischen Wirkstoffen, die zweite Gruppe lediglich ein Placebo, ein Scheinmittel, die berühmte Zuckerpille ohne Wirkstoffe. Wichtig ist, dass weder die Patienten, noch die Ärzte wissen, ob sie mit dem Medikament (dem »Verum«) arbeiten oder ob sie das Placebo erhalten, deshalb wird die Studie »doppelblind« genannt. Auch die Versuchsleiter wissen während des Experiments nicht, wer zu welcher Gruppe gehört, damit sie bei der Auswertung unvoreingenommen sind.
Das Placebo löst bei einigen Patienten eine starke Reaktion aus, manchmal ist es ebenso wirkungsvoll wie das neue Medikament, das getestet werden soll. Ein neues Mittel wird aber nur dann zugelassen, wenn es deutlich mehr Patienten heilt als das Scheinmittel in der Placebo-Gruppe. Eine Arznei, die diese Forderung nicht erfüllt, hat die Prüfung nicht bestanden.
Natürlich ist es sinnvoll, chemische Mittel ohne spezifische Wirkung nicht zuzulassen, denn was am Ende bliebe, wäre dann vor allem das, was auf dem Beipackzettel steht: Nebenwirkungen, jene »Kollateralschäden«, von denen schon die Rede war. Aber die Methode hat einen offenkundigen Nachteil, und der betrifft vor allem die logische Konsequenz, die sich aus solchen Versuchsanordnungen ergibt: dass Heilwirkungen, die sich nicht chemischen Prozessen zuordnen lassen, zu vernachlässigen sind. Was aber, wenn die Zuckerpille tatsächlich vielen Patienten hilft?
Wenn ein Placebo in 50 Prozent aller Fälle die Symptome lindert, vielleicht sogar eine Erkrankung vollständig zum Verschwinden bringt, wird es doch niemals als Medikament gelten, denn es diente ja nur als Hilfsmittel beim Test eines neuen Mittels. Keine Zulassungsbehörde würde eine Zuckerpille für den Verkauf freigeben, auch wenn sie im Vergleich noch so gute Werte erzielte; dies würden am Ende auch die Patienten als Betrug empfinden, denn auf dem Beipackzettel müssten die Hersteller ja eine chemische Zusammensetzung vorgaukeln, die in Wahrheit nicht existiert. Die Zuckerpille funktioniert eben nur, wenn Arzt und Patient von ihrer Wirkung vollständig überzeugt sind, sie ist also im eigentlichen Sinne kein Medikament, sondern nur ein Vermittler von Heilung.
Es ist so, als ob der Gedanke, dass eine Heilung geschehen kann, zunächst das Filter eines skeptischen, prüfenden Intellekts überwinden muss. Das zweifelnde Ich hat im Laufe vieler Jahre gelernt, dass nichts »von selbst« geschieht, dass Veränderungen stets eines Eingriffes von außen bedürfen. Je größer der Eingriff, umso größer die Wirkung, so erleben wir die Ereignisse des Alltags, und so sehen wir auch die Medizin. Die Placebo-Forschung hat herausgefunden, dass selbst Farbe und Größe einer Tablette wichtig sind: Rot wirkt eher aufmunternd, grün eher beruhigend, Kapseln wirken besser als kleine Tabletten. Und jeder von uns kennt das alte Wort von der »bitteren Medizin«: Wenn die Tropfen nicht süß sind, sondern bitter, wenn die Behandlung unangenehm ist, wenn es gar schmerzt, dann erwarten wir stets eine bessere Wirkung. Deshalb verschwinden Symptome schneller, wenn der Arzt eine Spritze verabreicht und keine Tabletten verschreibt, auch wenn die chemische Wirkung gleich sein sollte.
Es ist ein wenig wie bei einem Handel: Ich bin bereit, ein Opfer zu bringen, mich an Regeln zu halten, die mir ein Arzt auferlegt, und die bittere Medizin zu schlucken oder den Schmerz einer Spritze zu ertragen. Ich opfere also ein Stück meiner Freiheit oder meines Wunsches, jeden Schmerz zu vermeiden, und ich erhalte dafür die Kraft der Heilung.
Was geschieht, wenn sich ein Patient einer Operation unterzieht? Von allen medizinischen Handlungen sind Operationen sicher der stärkste Reiz für das skeptische Ich. Wenn schon Farbe und Größe von Medikamenten Einfluss auf den Geist nehmen, dann müssten sich bei Operationen besonders starke Effekte zeigen. Gegen diesen Gedanken spricht die intellektuelle Einsicht, dass es bei chirurgischen Eingriffen eher um »mechanische« Manipulationen geht, bei denen Krankes herausgenommen oder eine Verletzung repariert wird. Deshalb halten wir es für wenig wahrscheinlich, dass eindeutige Symptome durch den bloßen Scheinverschwinden könnten. Erstaunlicherweise aber tun sie genau das.
Bei weit verbreiteten Kniebeschwerden wenden Ärzte seit vielen Jahren eine Technik an, die sich »Athroskopie« nennt. Sie macht große Operationen unnötig und verlangt nur einen kleinen Schnitt unterhalb der Kniescheibe. Durch die Öffnung wird eine Sonde eingeführt, in der chirurgische Instrumente und eine kleine Kamera installiert sind: Der Operateur sieht den physiologischen Zustand in gestochen scharfen farbigen Bildern und kann unmittelbar Störendes entfernen und das Innere des Knies mit einer Spülung säubern.
Bei einem Experiment in den USA wurde ein Teil der Patienten aber nicht wirklich operiert. Der Chirurg machte lediglich einen kleinen, oberflächlichen Schnitt an der richtigen Stelle. Das Ergebnis des medizinischen Befundes war erstaunlich: die Heilungserfolge in der Gruppe der Patienten, die lediglich zum Schein operiert wurden, waren genauso groß wie in der Gruppe der Patienten, die wirklich operiert wurden.[14]
In einem zweiten Experiment erhielten Patienten mit einer schweren koronaren Arterienerkrankung, die starke und bedrohliche Herzbeschwerden hervorruft, eine moderne Behandlung, bei der ein Katheter eingeführt wurde, was häufig zu einer Linderung der Beschwerden führt. Eine zweite Gruppe wurde nur zum Schein behandelt, der Eingriff lediglich simuliert. Auch in diesem Fall erzielte die Gruppe mit der Scheinbehandlung gleich gute Ergebnisse.[15]
Experimente mit Operationen sind selten, denn aus ethischen Gründen verbietet es sich meist, Patienten die »wirkliche« Operation vorzuenthalten. Die beiden Tests werden deshalb sicher eine seltene Ausnahme bleiben. Aber sie haben gezeigt, dass die Macht des Geistes noch größer ist, als die Placebo-Forscher bisher anzuerkennen bereit waren.
Wenn sich Krankenschwestern und Ärzte im Operationssaal vorbereiten, die Instrumente bereitlegen, die Handschuhe überstreifen, dann bewegen sie sich wie in einer perfekten Inszenierung. Die Choreografie der OP-Vorbereitung und die Operation selbst folgen natürlich medizinischen Notwendigkeiten, vor allem dem Gebot der Antisepsis. Aber sie ist gleichzeitig ein Ritual, das dem Team das sichere Gefühl vermittelt, die bevorstehende Herausforderung bestehen zu können. Dieses Gefühl, seiner Sache vollkommen sicher zu sein, überträgt sich auch auf den Patienten: Die Gewissheit, in einen sicheren Raum zu kommen, in die Hände von Spezialisten, die alle denkbaren Probleme zu meistern gelernt haben, gibt ihm ein tiefes Vertrauen in die Möglichkeit der Heilung. Äußere Wahrnehmungen werden zu inneren Bildern, und diese Vorstellungen entfalten in der Seele des Patienten ihre Macht: Die Selbstheilungskräfte werden gestärkt, der Placebo-Effekt entfaltet seine Wirkung.
Kritische Mediziner ziehen aus den Ergebnissen der beiden Studien den Schluss, die beschriebenen Athroskopien und Katheter-Eingriffe seien offenkundig wirkungslos: Wenn die Placebo-Gruppe dieselben Ergebnisse erziele, dann gebe es ja offenbar keine »spezifische Wirkung«, also könne, ja müsse man diese operativen Eingriffe aus dem medizinischen Katalog streichen.
Tatsächlich hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr gezeigt, dass in den Kliniken der Welt viel zu häufig operiert wird. Nicht wenige Erkrankungen könnten durchaus ohne Chirurgie geheilt werden, und auch in Grenzfällen sollten Ärzte und Patienten immer bedenken, dass Operationen nie ohne Risiko sind.
Dennoch sind die Konsequenzen aus dieser Einsicht falsch, denn sie übersehen, warum die Scheinoperationen wirkten: weil es die wirkliche Operation ja tatsächlich gibt, und weil nach jahrelanger Erfahrung die Ärzte und deshalb auch ihre Patienten fest an den Erfolg dieser Techniken glaubten. Nur weil die Illusion perfekt war, weil also offenbar das geschah, was zehntausendfach erprobt wurde und anerkannter Stand der Wissenschaft ist, weil außerdem gleichsam das Opfer gebracht und der Preis vollständig bezahlt wurde, konnte die Heilung am Ende geschehen.
Trotz dieser erstaunlichen Forschungsergebnisse sind die Goldsucher der modernen Medizin nicht bereit, die Heilkraft des Geistes, die verborgene Fähigkeit zur Selbstheilung, in ihrer ganzen Konsequenz zu bedenken und Methoden zu ersinnen, die dieses Wunder, das in jedem von uns immer wieder geschieht, im medizinischen Alltag verfügbar zu machen. Die Fähigkeit zur Selbstheilung erscheint ihnen nur als störendes Grundrauschen der Seele bei der Reparatur des Körpers. Die Seele aber hat immer einen großen Anteil, wie alle Medikamentenstudien belegen. Niemals sind chemische Mittel vollständig »rein« zu testen: Weil die Placebo-Gruppe stets Wirkung zeigt, manchmal 20, manchmal 30, manchmal 50 Prozent und mehr, müssen wir akzeptieren, dass auch chemische Mittel nicht nur mit Chemie heilen. Jedes zugelassene Medikament, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, baut also zwangsläufig auch auf die Selbstheilungskräfte des Menschen, eine immaterielle Kraft mit messbarer Wirkung im Körper.
Wenn die Wirkung eines Placebo nur ein lästiges Störgeräusch im Konzert der Wirkstoffe wäre, dann dürfte in vergleichenden Studien kein Unterschied erkennbar sein zwischen Patienten, die nur eine Zuckerpille erhalten, und Patienten, deren Erkrankung völlig unbehandelt blieb. Auch in dieser Patientengruppe werden ja stets einige gesund, was die Wissenschaft als »Spontanheilung« bezeichnet.
Mehrere Medikamentenstudien der letzten Jahre haben diesen Gedanken berücksichtigt und den Patienten, die das neue Medikament erhielten, nicht nur eine Placebo-Gruppe, sondern eine gleich große Zahl von unbehandelten Patienten im direkten Vergleich gegenübergestellt. Stets zeigten sich bei den unbehandelten Patienten die geringsten Verbesserungen, bei den Placebo-Patienten aber deutlich stärkere Reaktionen, ein Beweis für die Wirksamkeit bedeutungsvoller Handlungen in der Medizin.
Als diese Ergebnisse unbestreitbar feststanden, gingen einige Wissenschaftler noch einen Schritt weiter. Sie erfanden Versuchsanordnungen, die auf chemische Medikamente vollständig verzichteten und ausschließlich die Wirksamkeit des Placebo testeten: In einem Versuch erhielten Asthmapatienten ein Wasser-Aerosol zur Inhalation, ein Mittel ohne Wirkstoffe. Die Ärzte erklärten, es handele sich um ein neues Präparat. In einer späteren Phase der Studie erhielten dieselben Patienten noch einmal die gleiche Zubereitung mit dem korrekten Hinweis, dieses Mittel bestehe lediglich aus Wasser. Auch diese Studie zeigte deutlich die klare Überlegenheit des Placebo: Nur wenn die Patienten glaubten, ein wirksames Mittel zu erhalten, ließen die Symptome nach, obwohl sich die beiden Inhalationssprays ja nicht voneinander unterschieden.[16]
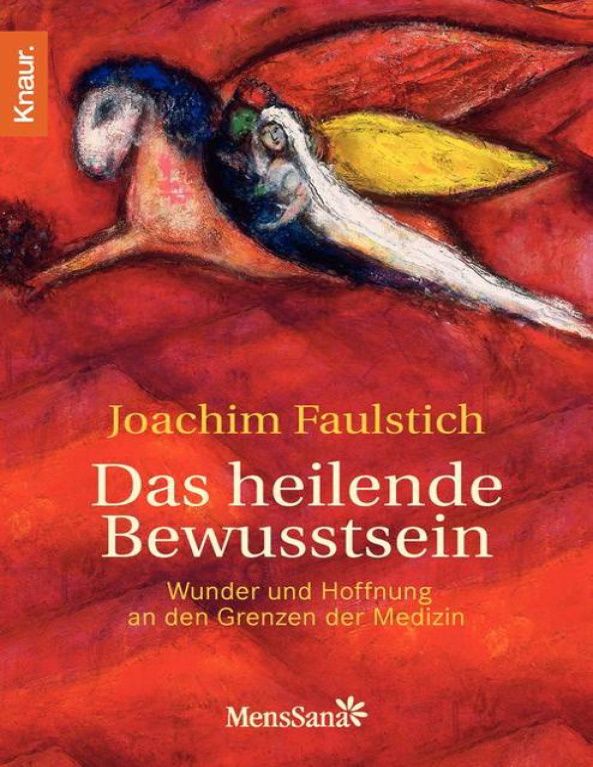
Impressum