13. Kapitel: Das Rassenproblem 1911: Die Juden und das Wirtschaftsleben von Werner Sombart: Dritter Abschnitt Wie jüdisches Wesen entstand
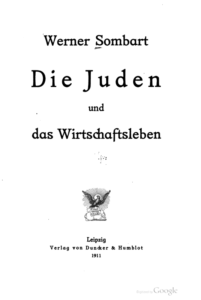
Das Rassenproblem
Vorbemerkung
Die Aufgabe, die ich mir in der Einleitung zu diesem Buche gestellt habe, ist jetzt, genau genommen, gelöst. Ich habe die Bedeutung der Juden, für das moderne Wirtschaftsleben in allen ihren Verzweigungen aufzuweisen versucht und bin den Zusammenhängen zwischen Judaismus und Kapitalismus in allen seinen Verästelungen nachgegangen, das heißt: habe dargetan, weshalb die Juden jene bedeutsame Rolle gespielt haben und noch spielen, wie sie zu ihren großen Leistungen teils durch objektive Umstände, teils durch ihre Eigenart befähigt worden sind.
Aber es kann nicht zweifelhaft sein, daß hinter diesen Antworten sich Fragen von neuem auftürmen, an denen ich nicht vorübergehen darf, wenn ich nicht Gefahr laufen will, daß die besten Leser dieses Buch mit einem Gefühl der schmerzenden Unbefriedigtheit aus der Hand legen. Denn in der Tat muß jeder, der mir bis hierher gefolgt ist, bis zu dem Punkt also, wo ich eine besondere jüdische Eigenart als die letzte Erklärung für den großen Einfluß angab, den die Juden in unserem Wirtschaftsleben gespielt haben; in der Tat muß jeder jetzt mit dringlichem Eifer fragen: nun, welcher Art ist denn diese jüdische Art selbst, woher kommt sie, wohin geht sie: Denn daß sie sehr verschiedener Natur sein kann, leuchtet bei näherem Hinsehen bald ein.
Sie kann, die jüdische Eigenart, nichts sein als gleichsam nur eine Funktion, der gar kein Organ entspricht; die überhaupt nur s0 lange da ist, als sie geübt wird; die vom Menschen selbst, der sie äußert, gar keinen Besitz nimmt, die von ihm gewebt werden kann, wie eine Feder von seinem Rocke, die also selbstverständlich dann auch mit dem Menschen, der sie trägt, verschwindet.
Oder sie kann sich dem, der sie hat, oder richtiger: der sie übt, einprägen, kann sich zu einer „Anlage“ verhärten, die die Übung wenigstens eine Zeitlang überdauert, wie die Schwielen in der Hand die Arbeit mit Beil oder Ruder überdauern. Diese Anlage braucht aber sich nicht auf die Kinder zu vererben, sie kann mit dem absterben, der sie erwarb.
Und dann kann diese Anlage wiederum so tief sich in das Wesen des einzelnen einprägen, daß sie von ihm auf seine Nachkommen übertragen wird, daß sie also „vererblich“ ist.
Weiter: vererbliche Eigenschaften (oder Anlagen: die beiden Ausdrücke mögen als Synonyme gelten; eine irgendwie feste Terminologie besteht, soviel ich sehe, in den biologischen Wissenschaften, in deren Ressort ja das Problem der Vererblichkeit gehört, nicht), vererbliche Eigenschaften können zu sehr verschiedenen Zeiten „erworben“ sein: in historischen Zeiten oder früher. Und was wir als jüdische Eigenart kennengelernt haben, kann also auch seit Anbeginn der Geschichte den Juden im Blute stecken oder im Lauf der Geschichte — im Altertum oder später — ihnen ins Blut gekommen sein.
Aber auch die vererbliche Eigenart kann nun wiederum „für immer“ oder für begrenzte kürzere oder längere Zeiträume den Menschen anhaften: sie kann demnach vergänglich, tilgbar sein oder nicht.
Da es sich ja hier immer um die Eigenart einer ganzen Bevölkerungsgruppe handelt, so enthalten diese Fragen gleichzeitig die Frage nach der „rassenmäßigen“ Abgrenzung jener Bevölkerungsgruppe, die Frage also, ob die Juden eine besondere Spielart oder Unterart der Menschheit bilden, die sich blutmäßig von den Völkern, unter denen sie leben, unterscheidet; die Frage aber auch: wie sie sich unterscheidet, ob die Verschiedenheiten (in der Steinmetzschen Terminologie) elementare oder distributive oder gemischte sind.
Wenn aber die Eigenart einer Bevölkerungsgruppe in Frage steht, so ist endlich noch zu beachten, daß die in den einzelnen Gliedern vorwaltende Eigenart auch entstanden sein kann (nicht durch Erwerbung neuer Eigenschaften, sondern) durch Blutsvermischung mit Angehörigen anderer Gruppen oder aber innerhalb der Gruppe selbst durch Auslese, Kollektiv-Psychologie bedeutet, wie wir sahen, immer die Feststellung von Eigenschaften, die in sehr vielen Individuen einer bestimmten sozialen Gruppe gleichmäßig wiederkehren. Dieselbe Gruppe umfaßt aber der Regel nach auch Individuen ganz anderer Art, oder genauer: andere „Varietäten“. Aus irgendwelchen Gründen kann sich nun das numerische Verhältnis der verschiedenen Varietäten innerhalb der Gruppe verschieben (durch Auslese), und die Gruppe, die zu einer bestimmten Zeit aus 3a, 2b, 3c gearteten Individuen bestand, besteht nun aus 1a, 2b, 3c gearteten Teilnehmern. Dann hat sich natürlich ihr kollektiv psychologischer Habitus verändert — meinetwegen unter dem Einfluß des „Milieus“ — ohne daß doch irgendwelche Eigenschaften „neu erworben“ wären.
So mannigfaltig sind die Möglichkeiten, die uns eine spezifische Eigenart erklärlich machen. Und schon der Überblick zeigt, wie verwickelt das Problem ist und —wie täppisch die meisten es behandeln.
Daß die Antworten gerade auf diese Fragen die eigentlich entscheidenden erst sind, bedarf keiner besonderen Begründung. Aber wir müssen, wenn wir ehrlich sind, auch sogleich gestehen, daß beim heutigen Stande unseres Wissens eine lückenlose Beantwortung dieser wichtigsten Fragen nicht möglich ist. Die Tendenzliteratur bringt zwar wie überall so auch hier immer schon Lösungen, aber wer sich auch nur ein wenig in den Gegenstand hineingelebt hat, der sieht einstweilen viel mehr Probleme, viel mehr Rätsel als Lösungen.
Was mir aber im gegenwärtigen Augenblicke not zu tun scheint, und was allein die Erörterung des Judenproblems aus dem Zwielicht, in dem sie jetzt steckt, herausbringen kann, ist eine begrifflich scharfe Erfassung der strittigen Punkte, ist eine klare Fragestellung und eine urteilsvolle Sichtung des massenhaft aufgehäuften Materials. Es ist als ob bei der Behandlung just der „Judenfrage“ und zumal an dem Punkte, wo sie mit dem allgemeinen „Rassenproblem“ sich schneidet, alle Teufel sich verschworen hätten, um die Köpfe zu verwirren.
Was Friedrich Martius unlängst für die Vererbungsfrage, im besonderen forderte (518), das ist für die gesamte Rassenfrage und in ganz hervorragendem Maße für die jüdische Rassenfrage vonnöten: „eine genauere Begriffskritik“. Und diese kann wohl auch — oder gerade? — derjenigen fördern helken, der den Spezialforschungen gleichmäßig fernsteht, und der deshalb die Ergebnisse auf den einzelnen Wissensgebieten besser zu überblicken vermag. Diese Überlegung gibt mir den Mut, im folgenden eine Zusammenfassung dessen zu versuchen, was heute die Erörterung des jüdischen Rassenproblems zutage gefördert hat: an sicherem Wissen und an denkbaren Möglichkeiten, aber auch, soweit es sich um sehr verbreitete Irrtümer handelt, an zweifellos falschen Hypothesen.
I. Die anthropologische Eigenart der Juden
Über die Herkunft der Juden und ihr anthropologisch ethologisches Schicksal sind jetzt die Meinungen wenigstens in den entscheidenden Punkten geklärt.
Man nimmt wohl ganz allgemein an (519), daß Israel sowohl wie Juda durch die Vermischung verschiedener orientalischer Völker entstanden sei. Als im 15. Jahrhundert „die Hebräer„, ein Beduinenstamm, sich in Palästina „seßhaft“ machen wollen, finden sie dort schon eine seit langem angesiedelte Bevölkerung vor: die Kanaaniter, die selbst wahrscheinlich eine herrschende Oberschicht darstellten und neben Hethitern, Pheresitern, Hevitern und Jebusitern (Jud. 3, 5) das Land bewohnten. Mit allen diesen Völkerschaften leben die israelitischen und judaischen Stämme – das ist jetzt das Ergebnis neuer Untersuchungen gegenüber der früheren, entgegengesetzten Meinung — im Konnubium.
Als dann ein Teil der Bevölkerung (wir werden später sehen, welcher) in die Exile geführt wird, setzt sich die Mischung dort fort. Von dem Schicksal der Juden im babylonischen Exil, das für uns allein in Betracht kommt, sind wir durch die neueren Keilschriftfunde, wenigstens was ihr sexuales Verhalten anbelangt, ziemlich genau unterrichtet: die Inschriften machen es „zweifellos„, daß eine allmähliche Verschmelzung zwischen Babyloniern und jüdischen Exilanten sich anbahnte. Wir sehen die Einwanderer ihren Kindern babylonische Namen geben, die Babylonier umgekehrt ihren Kindern persische, hebräische, aramsische Namen (520).
Nicht so einhellig sind die Ansichten darüber; wie die einzelnen Stämme und Völker, aus denen sich die Juden zusammensetzten, unter einander verwandt waren, noch auch darüber, wie man sie gegen andere Volksgruppen abgrenzen, und am wenigstens darüber, wie man sie — benennen soll. Man weiß, daß ein besonders erbitterter Streit um den Begriff „Semiten“ entbrannt ist, der wohl damit geendigt hat, daß man heute in anthropologischen Kreisen das Wort „Semiten“ überhaupt nicht mehr gern gebraucht.
Der Semitenstreit ist einer der Fälle (ein anderer bekannter Fall ist der Arierstreit), wo eine unnütze Verfilzung der Fäden dadurch herbeigeführt ist, daß man linguistische und anthropologische Gesichtspunkte bei der Abgrenzung von Menschengruppen durcheinander gebracht hat. Wir wissen heute, daß „Semiten“ ein rein linguistischer Begriff ist, daß nämlich alle diejenigen Völker darunter zu verstehen sind, deren Sprachen semitisches Gepräge tragen, und wissen ferner, daß diese semitisch redenden Völker aus den anthropologisch zum Teil heterogensten Elementen zusammengesetzt sind (521).
Mir scheint der Streit um Abgrenzung und Benennung jener orientalischen Völker, zu denen ebenso die Ägypter wie die Babylonier und Assyrier, wie die Phönizier wie die Juden — kurz alle Kulturvölker des alten Orients — gehören, aber auch ziemlich müßig. Ob wir mit Friedrich Müller von Hamiten und Semiten; ob mit v. Luschan von Semiten, Amoritern, Hethitern und Kuschiten, ob mit Huxley und Stratz von melanochroen Völkern reden: ich fürchte, wir werden angesichts des völligen Mangels an Untersuchungsmaterial ihre anthropologische Eigenart doch niemals genau und einwandsfrei feststellen können. Während auf der anderen Seite diese Lücke unseres Wissens gar nicht so sehr bedeutsam ist, angesichts der viel wichtigeren und unbestrittenen Tatsache, daß es sich bei all diesen Völkern zweifellos um Angehörige einer ihrer Herkunft und vorgeschichtlichen Lebensweise nach ganz genau bekannten Menschheitsgruppe handelt, die man vielleicht (ich komme noch darauf zu sprechen) als Wüstenvölker oder Wüstenrandvölker bezeichnen kann. Denn die Annahme, daß in diese heißen Länder ein blonder, blauäugiger, nordischer Stamm verschlagen sei, wird heute wohl von den Fachleuten übereinstimmend in das Reich der Fabel verwiesen. Jedenfalls wird man sich dieser germanomanen Hypothese (522) gegenüber so lange ablehmend verhalten dürfen, als nicht schlüssigere Beweise wie die blonden (roten) Haare des Königs Saul oder die Dolichozephalie der Mumie Ramses II. beigebracht worden sind.
Welches ist nun das Blutschicksal dieses Völkergemisches geworden, aus dem vir die Juden hervorgehen sehen? Darauf gab man früher gern die Antwort, daß das jüdische Volk in allen folgenden Jahrhunderten immer so weiter sich mit den Völkern, dann später in der Diaspora gemischt habe, wie vor dem babylonischen Exil und vährend der ersten Zeit in Babylonien selbst. Renan, Loeb, Neubauer und andere waren der Ansicht, daß die heutigen Juden zum großen Teil Abkömmlinge der heidnischen Proselyten während der hellenistischen Epoche oder aber auch Sprößlinge von Mischehen zwischen Juden und Wirtsvölkern in den christlichen Jahrhunderten seien. Das Vorkommen blonder Juden (bis 13%), namentlich in den osteuropäischen Ländern, bot zu der abenteuerlichen Hypothese den Anlaß: hier habe man es mit Mischlingen jüdischen und germanischen (oder slavischen) Volkstums zu tun. Die heute geltende — soweit ich sehe von fast allen maßgebenden Forschern geteilte — Meinung ist im Gegenteil die: daß der jüdische Volksstamm etwa seit Esras Zeiten bis heute im wesentlichen sich vermischt fortgepflanzt hat, seit mehr als 2000 Jahren also eine von fremden Völkern unberührte, ethnisch eigenartige Menschengruppe darstellt. Daß Tropfen fremden Blutes in den jüdischen Volkskörper während der langen Zeit der Diaspora hineingekommen sind, wird natürlich von niemandem geleugnet. Aber man glaubt, daß diese Vermischungen zu unbedeutend sind, um den ethnischen Charakter des jüdischen Volkes wesentlich zu beeinflussen.
Jedenfalls kann man jetzt mit ziemlicher Sicherheit feststellen, daß man früher namentlich den Umfang des Proselytentums ganz erheblich überschätzt hat. Zweifellos hat das Judentum während der hellenistischen und urchristlichen Zeit (die späteren Jahrhunderte kommen — bis auf einen Sonderfall, überhaupt nicht in Betracht) unter den heidnischen Völkern Anhänger für seine Lehre gefunden: beschäftigt sich doch sowohl die jüdische wie beispielweise die römische Gesetzgebung mit solchen Menschen. Aber wir dürfen heute mit Bestimmtheit annehmen, daß es bei jenen Proselyten sich immer nur um sog. „Proselyten vor dem Tor“ handelte, das heißt um Bekehrte, die zwar den Gottesdienst übten, aber nicht zur Beschneidung und nicht zum Konnubium zugelassen wurden (die, nebenbei bemerkt, fast alle dem Christentum verfielen.) Seit Pius wurde den Juden und den Judenkindern die Beschneidung wieder gestattet, ihre Ausdehnung auf die Proselyten aber ausdrücklich verboten. Dadurch wurde der förmliche Übertritt zum Judentum ein strafbares Verbrechen „und wahrscheinlich ist das Verbot eben in diesem Sinne nicht erlassen, aber aufrecht erhalten wordenes“ (523). Severus „Judaeos fieri sub gravi poena vetuit.„
Aber mag man immerhin, namentlich in vorchristlicher Zeit auch völligen Übertritt zum und somit blutsmäßigen Eintritt in das Judentum vermuten: angesichts der Millionen Juden, die wir in der hellenistischen Epoche schon annehmen müssen, kann es sich doch immer nur um verschwindend geringe Dosen fremden Blutes gehandelt haben, das hier in das Judenvolk hineinfloß, und dieses wenige Blut wird zudem noch von stammesverwandten Völkern (in Kleinasien, Ägypten usw.) hergerührt haben.
Daß der Proselytismus bei den Juden seit ihrem Eintritt in die europäische Geschichte so gut wie ganz aufgehört hat, darf als sicher angenommen werden. Und auch die abenteuerliche Bekehrung der Chazaren Chagane im 8. Jahrhundert wird an der Tatsache nichts ändern, daß auf dem Wege des Proselytismus den Juden während des Mittelalters keine irgendwie belangreiche Masse fremden Blutes zugeflossen ist. Es heißt wirklich allen Sinn für historische Dimensionierung verleugnen, wenn man aus jenem Übertritt der Chazaren Chagane zum Judentum auf eine starke Beimischung der östlichen Juden mit slavischen Elementen schließt. Das „Chazarenreich“ hat nie eine irgendwie nennenswerte Ausdehnung gehabt. Schon im 10. Jahrhundert wird es auf ein ganz eines Gebiet — im wesentlichen die Krim — zurückgedrängt, und im 11. Jahrhundert geht der winzige jüdische Staat der Chazaren unter. Ein kleiner Rest chararischer Juden lebt (als Karder) in Kiew weiter, Wollte man also auch annehmen, daß das ganze „Volk“ der Chazaren sich zum Judentum bekehrt (und nebenbei sich auch dauernd zum Judentum bekannt habe, so würde diese Beimischung immer noch erst eine Quantité négligeable gewesen sei, die an dem ethnischen Charakter des jüdischen Stammes gewiß nichts zu ändern vermocht hatte. Zu allem Überfluß ist es nun aber noch zweifelhaft, ob der Übertritt sich nicht auf die Herrscher oder die herrschende Klasse beschränkt habe (524).
Bleiben die Mischehen als Quell der Blutsvermengung. Daß auch sie in manchen Epochen der jüdischen Geschichte stattgefunden haben, dürfen wir als ausgemacht ansehen. Teils berechtigen uns zu dieser Annahme Schlüsse aus der allgemeinen Lage des Judentums. Wir dürfen erwarten, daß die Mischehen zwischen Juden und Nichtjuden in den Zeiten besonders häufig waren, in denen sich die Bande der jüdischen Gemeinschaft im lockern begannen: also etwa in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten oder im 12. und 13. Jahrhundert in Spanien. Aber wir wissen auch, daß diese Lockerung immer nur ganz vorübergehender Natur war, daß die jüdische Orthodoxie sehr bald wieder für Zusammenschluß und schroffe Abschließung gegen Andersgläubige Sorge trug. Was die Pharisäer in der hellenistischen Zeit vollbrachten, war im 13. Jahrhundert in Spanien eine Folge des Maimunistreites, der zu solcher Reaktion führte, daß sogar schon geschlossene Ehen mit Christinnen und Muhamedanerinnen gelöst wurden (525).
Andernteils weisen ausdrückliche Verbote jüdisch-christlicher Mischehen, deren wir während der früheren Jahrhunderte auf den spanischen Konzilen begegnen, darauf hin, daß sie jedenfalls vorgekommen sind: der Kanon 16 des Konzils von Elovia (304) bestimmt: Die Töchter von Katholiken sollen Ketzern nicht zur Frau gegeben werden: es sei denn, diese bekehrten sich zum Katholizismus; dasselbe gilt für Juden und Schismatiker, Kan. 14 des 3. Konzils zu Toledo (589) verbietet Juden, sich Christinnen als Eheweiber oder Maitressen zu halten. Alle solchen Verbindungen entsprossene Kinder sollen getauft werden. Nach Kan. 63 des 4 Tol. Konzils (633) müssen Juden, die Christinnen zur Frau haben, das Christentum annehmen, wenn sie mit ihrer Frau weiter leben wollen. Daß die gegen diese Verbote verstoßenden Ehen sehr häufig gewesen sein sollten, ist kaum anzunehmen. Die Infizierung des jüdischen Stammes mit spanischem Blut ist um so weniger bedeutend gewesen, als sicher ein Teil der wirkliche Mischehen eingehenden Juden, oder wenigstens ihre Kinder, dem Judentum verloren gingen.
Eine Vermischung mit den nordischen Völkern in irgendwie erheblichem Umfang liegt nun ganz und gar außer dem Bereiche aller Wahrscheinlichkeit. Denn wir wissen jetzt, daß die früher gelegentlich geäußerte Meinung: die Juden hätten z. B. in Deutschland bis zu den Kreuzzügen inmitten und im Verkehr mit der christlichen Bevölkerung gelebt, sich nicht aufrecht erhalten läßt. Brann, vielleicht der beste Kenner der deutsch-jüdischen Geschichte, erklärt die Annahme einer bis zu einem gewissen Grade, gediehenen Assimilation im frühen Mittelalter für
„ein in der Luft schwebendes Phantom, das vor der richtigen Erkenntnis des inneren Lebens der deutschen Juden jener Tage in nichts zerfließen muß“ (527).
Nun waren aber immer noch die blonden Juden da, die ein wandelnder Beleg für eine sogar recht beträchtliche Mischung mit blonden Wirtsvölkern zu sein scheinen, zumal ihre Zahl in nordischen Ländern (namentlich in Deutschland und Rußland) tatsächlich größer ist als in südlichen Ländern mit dunkler Landesbevölkerung. Heute nimmt eine Entstehung dieser blonden Juden auf dem Wege legitimer Vermischung mit den Wirtsvölkern, soviel ich sehe, kein einziger Forscher mehr als wahrscheinlich an.
Dagegen ist unlängst die Hypothese aufgestellt worden (528): die blonden Juden seien das Ergebnis illegitimer Paarungen mit Russen, entweder offizieller, nach denen die Judenweiber wieder zu ihren Männern zurückgekehrt seien, oder gewaltsam erzwungener, als das Ergebnis von Schändungen der Jüdinnen durch Kosakenwildlinge bei Gelegenheit von Pogromen. Daß diese Hypothese auf sehr schwachen Füßen steht, leuchtet ein. Wenn sie selbst die Entstehung der blonden Juden in Rußland erklären würde: für die übrigen Länder versagt sie völlig; für Deutschland z. B., weil die blonden Juden den blonden Germanen in anderen somatischen Merkmalen geradezu entgegengesetzt sind (Kurz, gegen Langköpfe); in südlichen Ländern, weil hier die massenhafte blonde Umgebung fehlt; und doch treffen wir selbst in Nordafrika und im heutigen Palästina blonde Juden an.
Es läßt sich deren Dasein aber auch zwanglos erklären ohne Zuhilfenahme einer Mischung mit fremden Völkern in späterer Zeit. Und zwar durch die Feststellung, daß alle dunkeln Rassen spontan entstandene leukoderme Varianten aufweisen, die sich dann in einer für sie besonders gut geeigneten Umwelt, (den nordischenLändern) stärker vermehrt haben als anderswo. Die bessere Anpassung mag nun klimatisch gedacht werden, oder sie mag sich vollzogen haben durch die Vermittlung einer künstlichen Auslese durch die Frauen, deren Schönheitsideal inmitten blonder Völker sich mehr dem blonden Typus zugeneigt hat (529).
Diese Annahme: daß die Juden sich mehr als zwei Jahrtausende hindurch als eine besonders geartete ethnische Gruppe erhalten haben, findet nun aber ihre vollgewichtige Bestätigung in der Tatsache, daß die anthropologischen Merkmale der heute lebenden Juden auf der ganzen Erde eine sehr große Übereinstimmung aufweisen, in keiner Weise mit den anthropologischen Eigenarten der Völker, unter denen sie leben, parallel gehen, dagegen selber eine auffallende Konstanz durch all‘ die Jahrtausende zeigen, während deren wir sie verfolgen können.
„Das verschiedene Schicksal, die andersartige Umgebung haben nicht vermocht, einen gemeinsamen, schier unverwüstlichen Typus zu verwischen; und gerade die Juden zeigen klarer als eine andere Rasse, wie übermächtig der Einfluß der Vererbung im Rassenschicksal gegenüber dem der Anpassung ist.“
(El. Auerbach.) „Immer tritt der Allotypus der Juden im Vergleich mit der übrigen, umgebenden Bevölkerung im gleichen Maße auf, was als unbestrittener Beweis für die Stabilität und Eigenart des anthropologischen Typus der Juden dienen kann. An der Richtigkeit dieser Tatsache zweifelt jetzt kaum jemand mehr.“ (Ark. Elkind.)
Die anthropologische Homogenität des jüdischen Stammes in der Gegenwart ist durch zahlreiche Ermittlungen und Messungen in anatomischer Hinsicht ziemlich sicher gestellt worden (530). (Überwiegen der Kurzköpfe der Brünetten usw.) Zweifelhaft ist nur, ob sich der seit alters her (wie wir zu verschiedenen Malen feststellen konnten) vorhandene Gegensatz zwischen Aschkenazim und Sephardim auch anthropologisch begründen läßt. Einstweilen stehen sich in der Erörterung dieser Frage zwei Meinungen schroff gegenüber (531). Mir scheint, als sei das Material, mit dem für und gegen die „Rassendifferenz“ der beiden Gruppen innerhalb der Judenschaft gekämpft wird, zu gering, um ein endgültiges Urteil zu fällen. (Daß in mancher Hinsicht eine anthropologische Unterschiedlichkeit zwischen Aschkenazim und Sephardim sehr wahrscheinlich ist, ist man auf Grund persönlicher Beobachtung anzunehmen sehr geneigt. Der schlanke, elegante Spaniole mit den schmalen Händen und Füßen, der scharfgebogenen, nochigen Nase Onkel Jason — und der plumpe, brummbeinige Aschkenaz mit der breiten, fleischigen Hethiternase – Vetter Julius – erscheinen dem Laien durchaus als zwei verschiedene Typen. Aber wie gesagt: einstweilen besteht noch keine Möglichkeit, dieses „Empfinden, zu einer wissenschaftlich begründeten Erkenntnis zu gestalten.)
Strittig ist im Augenblick auch noch; ob die heutige Judenschaft in physiologisch-pathologischer Hinsicht einheitlich und unterschiedlich von den umgebenden Völkern veranlagt sei, Daß bestimmte physiologisch-pathologische Besonderheiten den Juden anhaften, kann nicht bestritten werden: frühe Menstruation, mangelnde Disposition für Krebs, namentlich Gebärmutterkrebs, starke Disposition für Diabetes, Geisteskrankheiten usw. Aber diejenigen, die eine physiologisch-pathologische Eigenart der Juden leugnen, glauben jene Besonderheiten aus der sozialen Stellung der Juden, ihren religiösen Gebräuchen usw. genügend erklären zu können (532). Man wird sagen müssen, daß auch für den Entscheid in diesem Punkte das Material, auf das sich die Beurteilung stützen muß, noch nicht umfangreich genug ist und daß wir einstweilen uns mit einem non liquet zufrieden geben müssen.
Was dagegen wiederum außer allem Zweifel steht, ist die physiognomische Verwandtschaft der Juden in der Gegenwart. Die Physiognomie ist bekanntlich das Produkt zweier Faktoren: bestimmter Gesichtsformen und bestimmter Ausdrucksweisen in diesen und mittels dieser Formen. Sie entzieht sich der Messung und Auszählung, denen alle anderen somatischen Eigenschaften unterliegen und muß geschaut werden. Ebensowenig wie es für den Farbenblinden Farben auf der Welt gibt, ebensowenig kann es für den Menschenblinden Physiognomien geben. Wenn Friedrich Hertz beispielweise von sich sagen würde (533), daß er „bei gut drei Viertel der gebildeten und wohlhabenden Juden …. nicht mit voller Sicherheit die Abstammung aus dem Äußeren feststellen“ könne, so ließe sich dagegen gewiß nichts einwenden. Dagegen möchte ich mich entschieden gegen seine Behauptung wenden: das könne „ein guter Beobachter“ nicht feststellen.
Darin irrt er. Schon ein mittelmäßiger Beobachter kann es mit ziemlicher Sicherheit. Daß „die jüdische Physiognomie heute noch eine Realität ist, wird nur von ganz wenigen in Zweifel gezogen werden. Wobei zu beachten ist, daß es selbstverständlich unter den Juden zahlreiche Individuen gibt, die ganz und gar nicht „jüdisch“ aussehen und ferner: daß auch unter nichtjüdischen Völkern Judenphysiognomien vorkommen. Ich möchte zwar nicht mit Stratz (534) die Habsburger wegen ihrer herabfallenden Lippe oder die französischen Ludwige wegen ihrer starken Nasen als jüdisch aussehend bezeichnen; aber unter manchen orientalischen Völkern (vielleicht auch unter den Japanern) finden sich zweifellos jüdische Typen, die (dem Religionsbekenntnis nach) keine Juden sind. Aber das scheint mir nichts gegen die anthropologische Besonderheit der Juden zu beweisen, sondern nur dafür, daß jene Völker und die Juden vielleicht gemeinsame Vorfahren haben. (Nach Japan verlegt man bekanntlich — wie übrigens an andere Orte der Erde auch – das Endziel der Wanderung der verschollenen zehn Stämme Israels: die außerordentliche Ähnlichkeit, die zwischen japanischem und jüdischem Wesen obwaltet, würde eine solche — im übrigen natürlich völlig phantastische Hypothese vortrefflich stützen!) Die Judenphysiognomie als Dekadenzerscheinung ganz allgemeiner Natur anzusehen, wie es Stratz tut, oder sie (wie Ripley) aus dem Gettoleben zu erklären, geht nun aber auch nicht wohl an angesichts der zweifellosen Tatsache, daß wir den echten Judentypen auf den Denkmälern Ägyptens und Babyloniens schon in sehr früher Zeit begegnen. Man braucht nur die Abbildungen der jüdischen Kriegsgefangenen aus der Epoche Schischaks (973 v. Chr.) oder die Gesandten am Hofe Salmanassars (884 v. Chr.) sich anzuschauen (535), um festzustellen, daß sich seit jener Zeit bis heute, also in bald dreitausend Jahren, wesentliche Veränderungen in der Judenphysiognomie nicht vollzogen haben. Auch daraus wird man eine Bestätigung für die Richtigkeit der Anschauung entnehmen können, daß der jüdische Volksstamm in anthropologischer Hinsicht eigenartig ist und daß seine Eigenarten eine außergewöhnlich große Konstanz aufweisen.
II. Die jüdische „Rasse“
Dürfen wir nun angesichts dieser Tatsache von einer jüdischen „Rasse“ sprechen? Offenbar hat die Antwort auf diese Frage die Voraussetzung, daß das, was eine „Rasse“ sei, feststehe. Dies ist aber nun nicht der Fall, wie man weiß. Wir haben fast so viel Definitionen des Begriffes „Rasse“, wie wir Gelehrte haben, die von ihm sprechen. Nun steht es natürlich jedermann frei, zu sagen; das nenne ich Rasse, und wenn das Rasse ist, was ich so und so gekennzeichnet habe, dann sind die Juden eine Rasse, oder sind sie keine Rasse. Daß dieses Verfahren ein je nach dem Grad von Bösartigkeit oder Dummheit dessen, der sich seiner bedient, mehr oder weniger harmloses Spiel ist, liegt auf der Hand. Eine irgendwelche Bedeutung für den Betrieb der Wissenschaft bekommt es immer erst, wenn der einzelne sich klar ist und den andern klar macht, was er eigentlich will; heißt: welchem Zweck seine Begriffsbestimmung dienen soll. Diese Einsicht dämmert jetzt endlich auch den „Rassentheoretikern“ auf, und die wissenschaftlichen unter ihnen versuchen jetzt dem Begriffe Rasse ein erkenntnisskritisches Fundament zu unterbauen. Man sieht vor allem ein, daß man sehr verschiedene Begriffe mit dem Namen Rasse belegt hat, und daß es etwas grundanderes bedeutet, wenn ich sage: dieses Frauenzimmer ist rassig (hat Rasse), als wenn ich sage: dieser Mensch gehört der mongolischen Rasse an. Das heißt: man sieht ein, daß im einen Fall mit dem Worte Rasse ein irgendwelches Zweck- oder Idealgebild bezeichnet werden soll, während das Wort Rasse im andern Falle nur einen klassifikatorischen Sinn hat. Während nun in letzter Zeit das Wort Rasse in jenem züchterischen Verstand mit Entschlossenheit weiter verwandt wird, ist man von seiner Verwendung zum Zwecke lediglich ordnender Menscheneinteilung mehr und mehr zurückgekommen. Das heißt aber nichts anderes als das: man hat darauf verzichtet, die Menschen, die heute auf der Erde leben, nach anthropologischen Merkmalen zu Kassifizieren; anders gewandt: sie nach „Varietäten“ (Unterarten, Spielarten) zu unterscheiden.
„Bei dem Stande der heutigen Forschung können gegenwärtig alle Versuche, die Menschheit nach ihren körperlichen Verschiedenheiten in scharf voneinander getrennte Gruppen (Rassen oder Varietäten) zu trennen, nur provisorischen Wert haben. Hier sieht noch niemand klar, und kann noch niemand klar sehen.“ (Joh. Ranke.)
Im Grunde ist dieses negative Ergebnis der klassifizierenden Anthropologie nicht zu verwundern, wenn man bedenkt, wie grob die wirklich feststellbaren „Merkmale“ der menschlichen Art sind, und vor allem, wie fern wir mit ihnen auch nur dem leiblichen Menschen in seiner organischen Einheit bleiben. Wenn für irgend eine Wissenschaft, gilt von der modernen Anthropologie das verhängnisvolle Wort: „Hat die Teile in ihrer Hand, fehlt leider nur das geistige Band.“ Schädelform, Prognathismus, Gesichtsform und Gesichtswinkel, Nase, Ohr, Körpergröße, Hautfarbe, Haare, Steatopygie, weibliche Brust: das sind die Merkmale, die man ermittelt. Aber was jedes einzelne für den Gesamtorganismus bedeutet, was eines für das andere bedeutet, wie eines vom andern abhängt davon ahnen wir kaum etwas, und werden wir vielleicht niemals Gewisses erfahren. Kein Wunder also, daß die Feststellung der verschiedenen Merkmale bei verschiedenen Menschengruppen ganz und gar keine Einheitlichkeit, sondern immer nur eine fast karikaturhafte Buntscheckigkeit des Typus ergab.
Eine Zeitlang hatte man gehofft, mit exakten Messungen Ordnung in das Chaos bringen zu können, und hatte namentlich an die Schädelmessungen die höchsten Erwartungen geknüpft. Nun haben sich auch diese — und gerade diese als gänzlich ungenügend erwiesen, die Menschen in unterschiedliche Gruppen zu teilen: die dolichozephalen Menschen finden sich in den sonst heterogensten Völkerschaften, ebenso wie die Kurzköpfe zerstreut, Buschmänner und Neger, Athiopier und Drawida, Semiten und Nordeuropäer sind gleichermaßen ausgesprochene Langschädel und haben doch kein anderes anatomisches Merkmal miteinander gemein.
Jetzt fängt man an, die physiologisch-pathologischen Eigenarten der Völker zu untersuchen, um durch sie vielleicht bessere Einteilungen zu schaffen. Ob mit mehr Erfolg, steht dahin.
Vielleicht aber kommt die Erleuchtung noch von einer ganz andern Seite: von den Ergebnissen der biologischen Forschung her, nachdem diese angefangen hat, sich mit der chemischen Beschaffenheit des Blutes zu beschäftigen. Der Volksinstinkt, der so oft das Richtige trifft, hatte längst geahnt, daß „Blut ein ganz besonderer Saft“ sei, hatte deshalb von tief im Wesen des Individuums eingegrabenen Zügen gesagt: „es steckt ihm im Blute“ und hatte nicht von Haar oder Stimm, oder Nasen-, sondern von „Blutsverwandtschaften“ gesprochen. Nun hat in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Forschern sich mit der Frage beschäftigt: wie sich das Blut der einzelnen Tierarten charakterisieren und von denen anderer unterscheiden lasse, wie weit also die Blutanalyse zur Artdifferenzierung und Systematisierung zu verwenden sei. Die Untersuchungen von Bordet, Nutall, A. Wassermann, Uhlenhut. Friedenthal u. a. haben zu dem Ergebnis geführte (536), daß es jetzt mit Sicherheit gelingt, auf biologischem Wege Eweiß zweier selbst naher verwandter Arten voneinander zu unterscheiden und fernerhin gewisse Eiweißdifferenzen innerhalb eines Organismus festzustellen. Was fraglich blieb, war dies: ob mit derselben Methode auch Unterschiede innerhalb der Art festzustellen seien, ob man also die Blutanalyse auch zur Klassifizierung, z. B. der menschlichen „Rassen“, werde verwenden können. Die Arbeiten Neisserscher Schüler, namentlich Carl Brucksse haben diese Frage im bejahenden Sinne beantwortet. Untersuchungen an Holländern, Chinesen und Malayen haben gezeigt, daß in der Tat es mit Hilfe eines gegen Vertreter der weißen Rasse gerichteten Immunserums möglich ist, diese von Angehörigen der mongolischen und malavischen Rasse biologisch zu unterscheiden und gleichzeitig aus den erzielten Titergrößen auf die Verwandtschaft der einzelnen Rassen untereinander zu schließen.
Natürlich handelt es sich auch bei diesen Untersuchungen um erste Anfänge, und zu einem vollständigen Schema der menschlichen Rassen werden wir auch mit den biologischen Methoden einstweilen so bald nicht kommen.
Nun wäre es aber ein höchst bedenklicher Trugschluß, aus diesen Mißerfolgen der Klassifikationsbestrebungen zu folgern: daß es überhaupt keine anthropologisch besonderen Menschengruppen gabe. Weil wir bisher kein Einteilungsprinzip gefunden haben, braucht doch die Wirklichkeit nicht der Unterschiede zu entbehren! Und wir werden auch diese ethnischen Unterschiede der Menschengruppen wahrnehmen können, ehe uns die Ethologie oder Anthropologie oder Biologie oder Physiologie das Menschheitsklassifikationsschema geliefert hat. Wir werden sogar immer auch Mittel und Wege finden, diese Unterschiedlichkeit an einzelnen Merkmalen uns klar zu machen und mitzuteilen. Es wäre schlimm, wenn wir mit der Feststellung, daß der Eskimo ein anderes Gebilde ist wie der Neger, und der Süditaliener sich von dem Norweger unterscheidet, warten sollten, bis die Anthropologen ein brauchbares Klassifikationssystem ausgearbeitet hätten. Noch viel mehr als bei der Unterscheidung der Völkerpsychen pochen wir bei der Sonderung der verschiedenen Menschengruppen nach somatischen Eigenschaften auf unser gutes Recht als vernunftbegabte Beobachter, die sich nicht weismachen lassen, daß ein Vogel eine Katze sei, weil die Naturforscher vielleicht noch nicht herausgefunden haben, weshalb und worin die beiden sich voneinander unterscheiden. Nur nicht bange machen lassen! Wenn man wahrnimmt, mit wie dürftigen Mitteln beispielsweise die Anthropologie (notgedrungen!) arbeiten muß, so wird man bei aller Hochachtung vor ihren Errungenschaften — doch ihre Machtsphäre nicht allzuweit zu stecken geneigt sein.
Auf unser Thema angewandt: auch wenn wir die Juden nicht als eine besondere „Varietät“ der Menschheit schulgemäß klassifizieren können, ihnen darum alle anthropologische Eigenart abzusprechen, liegt kein Grund vor. Und ich kann mir ein Wort wie das v. Luschans „für mich gibt es nur (!) eine jüdische Religionsgemeinschaft, keine jüdische Rasse“ (538), nur als eine einer momentanen (sehr wohl verständlichen!) Gereiztheit entspringende, ab irato gemachte Bemerkung deuten, die ja schon deshalb v. Luschan nicht ihrem vollen Inhalt nach vertreten kann, weil sie mit seinen eigenen Forschungsergebnissen in vollem Widerspruch stehen würde. Ich kann verstehen, daß v. Luschan erklärt: „ich kenne keine jüdische Rasse, und damit meint: es gibt keine besondere jüdische Rasse 1. in dem Sinne einer besonderen „Varietat“ der Menschheit (aus oben dargelegten Gründen), 2. gibt es keine in dem (ganz willkürlichen und aus einer Verquickung des Hassifikatorischen Sinnes des Wortes Rasse mit seiner teleologisch-idealisierenden Bedeutung hervorgegangenen) Verstande einer „reinen“ Rasse (im Gegensatz zu einem Völkergemisch). Daß v. Luschan sich gegen diese Auffassung an jener Stelle insbesondere wenden wollte, geht aus den folgenden Worten hervor: „immer wieder von neuem auf das Völkergemisch hinzuweisen, aus dem die heutigen Juden bestehen, ist auch von praktischer Bedeutung. Aber wenn es nun auch in diesem doppelten Sinne keine jüdische Rasse gibt: gibt es darum „nur eine jüdische Religionsgemeinschaft ?!“ Man könnte mit Recht gegen diese Auffassung einwenden, daß es gewiß auch so etwas wie eine jüdische Volksgemeinschaft gäbe, die sich in gemeinsamen Geschichtserinnerungen, auch außerhalb der Religionsgemeinschaft, äußere. Aber gewiß mit dem selben Rechte kann man für die Judenschaft eine irgendwie geartete anthropologische Sonderheit — im Gegensatz zu den Wirtsvölkern — eine anthropologische Unterschiedlichkeit beanspruchen. Und selbst wenn wir kein einziges somatisches Merkmal anführen könnten, das dem Juden eigentümlich wäre und ihn von anderen Gruppen unterschiede, selbst dann noch würde ich nicht davon abzubringen sein, daß die Juden — wo auch immer ich sie anträfe, eine anthropologisch andersgeartete Gruppe seien als beispielsweise die Schweden oder die Neger. Also doch nicht nur „eine Religionsgemeinschaft„.
Man sieht: der Streit läuft auf einen Wortstreit hinaus. Es gibt keine jüdische „Rasse“ gut. Aber es gibt eine anthropologische Eigenart der Juden, Schade nur, daß wir zur Bezeichnung dieser Eigenart kein passendes Wort haben. Wir können von einem Volksstamm oder so etwas reden. Aber Name ist auch hier Schall und Rauch. Einigt man sich, was man unter dem (ach! so oft mißbrauchten) Wort verstehen will, so liegt eigentlich auch kein Bedenken vor, von einer jüdischen Rasse,meinettwegen „Rasse„, zu sprechen. Ich schließe diese Ausführungen mit ein paar sehr verständigen Worten des ausgezeichneten Judaisten A. Ruppin, die mir zu dem Besten zu gehören scheinen, was über „jüdische Rasse“ geschrieben ist: „Man darf„, meint Ruppin (539) „den Begriff der Rasse nicht überspannen„. (Ruppin denkt hier nur an die eine Bedeutung, die man dem Worte beigelegt hat.) Versteht man unter Rasse nur eine solche Gemeinschaft, die ihre charakteristischen anthropologischen Merkmale in vorgeschichtlicher Zeit ausgebildet und sich in geschichtlicher Zeit von jeder geschlechtlichen Vermischung mit anderen Gemeinschaften freigehalten hat, so gibt es unter den Menschen mit weißer Hautfarbe überhaupt keine Rassenverschiedenheit, denn sie alle sind im Laufe der Jahrhunderte wiederholt durcheinander gewürfelt worden. Ob die Juden von ihrem Eintritt in die Geschichte an eine einheitlich Rasse gebildet und diesen einheitlichen Charakter stets bewahrt haben, steht völlig dahin.
„Als sicher kann aber gelten, daß die Bekenner der mosaischen Religion noch gegen Ende des 18. Jahrhunderts nach vielen Jahrhunderten strengster Inzucht innerhalb eines relativ kleinen und räumlich beschränkten Kreises eine durch anthropologische Merkmale von ihrer christlichen Umgebung scharf unterschiedene Gemeinschaft bildeten.
„Die Gesamtheit derjenigen Personen, welche genealogisch von dieser Gemeinschaft abstammen, kann man — mangels eines besseren Wortes für anthropologisch einheitliche Menschengruppen — als eine Rasse und zwar als die jüdische Rasse bezeichnen.“
III. Die Konstanz des jüdischen Wesens
Was uns hier an diesen anthropologischen Feststellungen allein interessiert, ist der Zusammenhang, der etwa besteht zwischen gewissen somatischen Eigenarten und der geistigen Besonderheit des jüdischen Stammes. Denn was wir gern erfahren möchten, ist ja doch: ob diese im Blute liegt oder nicht, ob sie — wie der beliebte Ausdruck lautet – rassenmäßig begründet ist oder nicht. Um der Lösung dieser Frage näher zu kommen, müssen wir nun zunächst, ebenso wie bei den somatischen Eigenarten, auch bei der geistigen Eigenart nachschauen, welches ihre Schicksale während des Ablaufs der jüdischen Geschichte gewesen sind; nachschauen also, ob die Besonderheiten, die wir für Gegenwart und letzte Vergangenheit an dem jüdischen Volke beobachtet haben, etwa schon in früherer Zeit angetroffen werden, ob sie bis in die Anfänge der Geschichte zurückreichen, oder ob sie erst später (und wann vielleicht) sich eingestellt haben.
Da ist denn nun das Ergebnis dieses: daß das jüdische Wesen jedenfalls eine sehr große Konstanz aufweist, daß gewisse Besonderheiten, gewisse eigentümliche Züge der jüdischen Psyche sich annähernd so weit zurückverfolgen lassen, wie die Geschlossenheit der ethnischen Gruppe reicht, die wir Juden nennen.
Das läßt sich natürlich nicht oder doch nur sehr unvollkommen, unmittelbar feststellen, weil wir ja zuverlässige Schilderungen des jüdischen Volksgeistes aus früherer Zeit nur ganz wenige und ganz aphoristische besitzen. Immerhin ist es ganz lehrreich, wenn uns der Pentateuch (an 4 Stellen: Ex. 32, 9: 34, 9: Deut. 9. 13. 27) dasselbe sagt wie Tacitus: daß Israel ein hartnäckiges, ein halsstarriges Volk sei, und wenn uns Cicero von ihrem brüderlichen Zusammenhalten berichtet; oder wenn wir hören, daß Marc Aurel sie ein unruhiges Volk nannte, über das er jammernd ausrief: „0 Marcomanni, o Guadi, o Sarmataae, tandem alios vobis inquietiores inveni„; oder wenn Juan de la Huarte von dem scharfsinnigen für weltliche Dinge gemachten Verstande, von ihrer astucia, sollercia uns erzählt usw.
Aber aus diesen wenigen Gelegenheitsbemerkungen könnten wir uns doch kein rechtes Bild machen von dem Wesen des jüdischen Volkes in vergangenen Zeiten, Dazu kommen wir nur auf Umwegen: durch das Studium der äußern Lebensschicksale, der Lebensäußerungen des Volkes, aus denen wir wie aus Symptomen auf das innere Wesen, die seelische Eigenart zurückschließen.
Da erscheint mir nun vor allem bedeutsam:
1. die Stellung der Juden zu den Wirtsvölkern
(oder deren Stellung zu ihnen), seit sie in der Diaspora leben. Wir sahen: diese war in den letzten Jahrhunderten eine vorwiegend feindliche: die Juden wurden vom Volke als „Fremde“ von den Regierungen als „Halbbürger“ angesehen, ehe der Kapitalismus sie erlöste. Sie wurden gehaßt und verfolgt in allen Ländern, aber sie wußten sich überall zu erhalten und schließlich durchzusetzen.
Und nun schauen wir in die Vergangenheit zurück und beobachten dasselbe Schauspiel, seit wir sie mit Fremden in Verbindung kommen sehen: die Stimmung der Wirtsvölker ist immer dieselbe gewesen, mochten diese selbst einer Rasse oder Kultur oder Religion angehören, welcher sie wollten. Überall kam es schließlich zu innerer Gegensätzlichkeit, überall zu Verfolgungen und Mißhandlungen des Gastvolkes.
Von den Ägyptern nimmt es seinen Anfang: „Und es graute den Ägyptern vor den Kindern Israels“ (Ex. 1. 12).
„Allen Menschen zuwider“ meint Paulus (I. Thess, 2, 15), seien die Juden.
Während der hellenistischen Zeit, im kaiserlichen Rom: das selbe Bild. Grimmiger Haß, bei geringen Anlassen: Verfolgung, Plünderung, Mord und Todschlag. Man denke an die furchtbaren Pogrome in Alexandria während des ersten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, von denen uns Josephus und Philo berichten. „Der Judenhaß und die Judenhetzen sind so alt wie die Diaspora selbst“ (Mommsen). Man gedenke der Judenverfolgungen unter den römischen Kaisern, Mare Aurel: „foetentium Judgeorum et tumultuantium saepe taedio percitus„. Dann: Plünderungen und Massacres unter Theoderich, ebenso wie unter den Langobarden im 7. Jahrhundert. Aber auch: in Babylonien während des 6. Jahrhunderts schwere Verfolgungen durch die dem Feuerkultus ergebenen Perserkönige.
Selbst auf der Pyrenäenhalbinsel, wo sie so viel Gutes erfahren haben: am letzten Ende doch immer gehaßt und verfolgt: ganz gleich von Moslemim und Christen. Man erinnere sich der Drangsalierungen im 11. Jahrhundert im zividischen Reiche in Granada unter dem Wesirat des Joseph Ibn-Nagrela und schließlich ihrer Vertreibung aus Granada.
Das alles — und die Beispiele lassen sich leicht vermehren – sind Äußerungen des Judenhasses in nichtchristlichen Kulturkreisen, zu denen sich dann die reichlichen Verfolgungen in christlicher Zeit gesellen.
Das alles ist natürlich ohne die Annahme einer jüdischen Eigenart — und zwar der gleichen — nicht denkbar: kann nicht geflossen sein nur aus sinnloser Laune der so sehr verschiedenen Wirtsvölker.
Und immer wieder — zu allen Zeiten und in allen Ländern, (wenn auch nicht ununterbrochen) — als Halbbürger von den Machthabern behandelt, wo sie unter fremden Völkern lebten.
Nicht daß die Juden immer Halbbürger gewesen wären, weil man sie nicht für voll ansah und sie deshalb zurücksetzen wollte. Im Altertum waren sie vielmehr oft geradezu „privilegiert“ mit Vorrechten ausgestattet, kraft deren sie nicht gezwungen werden konnten, bestimmte Funktionen im Staate auszuüben (wie der Kriegsdienst), oder kraft deren bestimmte Gesetze (wie die über Vereine und Versammlungen) ihnen gegenüber nicht in Anwendung kamen. Aber das hinderte nicht, daß sie doch eben nicht vollen Anteil an dem Leben des Staates nahmen, in dem sie lebten. Bestritten doch beispielsweise die Hellenen den in Caesaraea (!) (also in einer auf jüdischem Boden und von einer jüdischen Regierung geschaffenen Stadt) lebenden Juden das Bürgerrecht und Burnus (gest. 62), der Minister Neros (540), gab ihnen Recht. Und während des Mittelalters änderte sich an diesem Zustand nur wenig.
Ich meine nun, daß eine derartig von den Staaten der verschiedensten Art gleichmäßig geübte Politik ebenfalls wieder in der bestimmten Eigenart des jüdischen Volkes — vielleicht nur in ihrem strengen Religionsgesetz, wie wir es in einzelnen Fällen nachweisen können — seinen Grund haben mußte.
Aber: allen Gewalten zum Trotz sich erhalten, versteht das Judenvolk seit ewigen Zeiten, Jenes wundersame Gemisch von Hartnäckigkeit und Schmiegsamkeit, das wir am Juden der Gegenwart feststellen konnten, bildet den Grundzug seines Verhaltens während des ganzen Verlaufs seiner Geschichte. Ein wahrer Stehauf! Niedergestreckt und nach kurzer Zeit wieder fest auf den Beinen. Man denke nur an den Widerstand, den das jüdische Volk den römischen Kaisern zu leisten wußte, als diese alle Mittel anwandten, um es als selbständiges Volk zu vernichten: allen Maßnahmen der Regierung zum Trotz gibt es im 3. Jahrhundert wieder einen Patriarchen in Jerusalem, der, wenigstens faktisch, die Jurisdiktion ausübt und — von der Regierung geduldet wird. Vom Altertum an durch das Mittelalter hindurch bis in die neueste Zeit hinein fassen die andern Völker ihr Urteil über die Juden in dem Wort zusammen; er ist hartnäckig (zäh) wie ein Jude: „ostinato come un ebreo“.
Am wunderbarsten hat sich diese Eigenart der Juden, schmiegsam und doch zäh zugleich zu sein, in dem Verhalten fremden Regierungen gegenüber in Sachen der Religion bewährt. Ihr hatten sie ja die meisten Anfeindungen, die meisten Verfolgungen zu danken. Und doch wollten sie ihre geliebte Religion nicht aufgeben. Da verfielen viele von ihnen auf den Ausweg: s0 zu tun als ob sie ihre Religion abgeschworen hätten und ihr im geheimen doch anzuhängen. Wir kennen dieses Verhalten aus der Zeit der Marranen, hier wollen wir feststellen, daß es so alt wie das Leben in der Diaspora ist.
Das massenhafte Auftreten der jüdischen Scheinheiden, Scheinmuhamedaner und Scheinchristen ist ein so fabelhaftes, so ganz einziges Ereignis in der Menschheitsgeschichte, daß man immer wieder staunen muß, wenn man davon liest und hört.
Zumal wenn man die besonderen Umstände bedenkt, unter denen dieses Scheintum betrieben wurde: daß es oft genug gerade sehr fromme Juden, daß es die offiziellen Vertreter des jüdischen Glaubens waren, die sich dieses Auskunftsmittels bedienten, um sich am Leben zu erhalten.
Angefangen bei jenem R. Eliesar b. Parta, der unter Hadrian als Scheinheide sich betätigte (541), bis zu jenem bekannten Ismael Ibn Nagrela, der als Rabbiner Samuel Vorträge über den Talmud hielt, eine Methodologie schrieb, gutachtliche Bescheide auf religiöse Anfragen erstattete und als Wesir des muselmanischen Königs Habus die Erlasse mit den Worten Chamdu-l- Illahi eröffnete und am Schlusse diejenigen, an welche die Regierungsschreiben gerichtet waren, ermahnte, ferner nach der Vorschrift des Islams zu leben (542); bis zu dem großen Maimuni, der sein Scheinmuhamedanertum mit guten Gründen glaubte rechtfertigen zu können es bis zu dem falschen Messias Sabbatai, der Muhamed bekannte, ohne daß sein Ansehen bei den Gläubigen verringert wurde; von dem neapolitanischen Juden Basilus an, der seine Söhne zum Scheine taufen ließ, um unter ihrer Firma den Sklavenhandel weiterzuführen (544) (der den Juden verboten vurde), bis zu den Tausend und Abertausend Marranen, die seit den Judenverfolgungen auf der Pyrenäenhalbinsel sich als Christen ausgaben und doch bei der ersten günstigen Gelegenheit zu ihrem alten Glauben zurückkehrten: welch sonderbarer Reigen von Menschen, in denen sich höchste Hartnäckigkeit mit höchster Schmiegsamkeit vereinigten!
Wir sahen: viele der jüdischen Eigenarten kamen erst in der Diaspora zu voller Entfaltung. Läßt sich nun aber
2. das Phanomen der jüdischen Diaspora selbst
restlos aus äußeren Umstanden, aus erduldetem Schicksal erklären? Bezeugt es nicht selbst wieder eine besondere Eigenart ? Anders gewandt: würde jedes beliebige andere Volk in gleicher Weise haben über den Erdball zerstreut werden können? Da die Versprengung schon zu Beginn unserer Zeitrechnung vollendet war, so ist die Frage mit Rücksicht lediglich auf die Juden des alten Palästina zu beantworten. Daß diese zu einem guten Teile gewaltsam aus ihren Sitzen verdrängt und von dem Eroberer gewaltsam in die Fremde verschleppt oder, wenn man die mildere Ausdrucksweise vorzieht: in fremde Länder angesiedelt wurden, ist bekannt.
Wir wissen von Tiglat Pilésser, der Trupps jüdischer Bevölkerung in Medien und Assyrien ansiedelte; ebenso wie ja ansehnliche Teile der Judenschaft zwangsweise nach Babylon ins Exil geführt wurden. Ebenso bekannt ist es, daß Ptolemeus Bagi Tausende von Juden aus Paldstina nach Ägypten eingeschleppt und wiederum einen Teil der ägyptischen Juden als Kolonie nach Cyrene versetzt haben soll, bekannt, daß Antiochus der Große 2000 jüdische Familien aus Babylonien holte, um sie im Inneren Kleinasiens, Phrygien und Lydien anzusiedeln, Mommsen nennt die Judenansiedlungen außerhalb Palästinas geradezu „eine Schöpfung Alexanders oder seiner Marschälle“
Man könnte nun versucht sein, wenigstens in diesen Fällen, in denen die Juden ohne oder gegen ihren Willen irgendwo angesiedelt wurden, eine rein äußerliche Schicksalserzwingung zu erblicken, die unabhängig von jeder Eigenart des jüdischen Volkes sich vollzogen hätte. Aber das wäre ein übereiltes Urteil, Man sollte vielmehr das bedenken: hätten die Juden nicht besondere Eigenschaften besessen, so hätte man sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht verpflanzt. Diese Ansiedlungen hatten doch nur einen Sinn, wenn sich die Gewalthaber von ihnen einen Vorteil versprachen: für das Land, aus dem man die Juden fortführte oder (meist wohl) für das Land oder die Stadt, in die man sie versetzte. Man mußte sie in ihrem eigenen Lande fürchten als Unruhestifter, oder man mußte sie schätzen als reiche oder betriebsame Bürger, mit deren Hilfe man einer Neuansiedlung zum Aufschwung verhelfen wollte, wenn nicht besondere Gründe einen Fürsten zur Deportation bestimmten, wie etwa den Ptolemeus Lagi, der ägyptische Juden (wie schon erwähnt wurde) als Kolonie nach Cyrene schickte, um durch ihre Anhänglichkeit seine Herrschaft über Cyrene zu befestigen.
Eine Ahnliche Erwägung läßt uns auch dort ein subjektives Moment volklicher Eigenart in die Kausalkette einschieben, wo die Juden Palästina etwa aus einer Art von ökonomischem Zwange verließen: weil der Nahrungsspielraum zu klein wurde für die anwachsende Bevölkerung: ein Motiv der Abwanderung und also eine Ursache der Diaspora, die angesichts der Natur Palästinas gewiß recht häufig gewesen ist. Aber damit es zu dieser Zwangslage kam, war schon eine völkliche Eigenart Voraussetzung: die starke Bevölkerungszunahme (die bekanntlich ebenso sehr physiologischen wie psychologischen Momenten, ihre Entstehung verdankt). Und daß die Zwangslage zur Abwanderung führte, setzte erst recht wieder eine völkliche eigenartige Veranlagung voraus. Man hat die Juden oft mit den Schweizern verglichen. Gewis, auch die Schweizer wandern s0 viel aus, weil die Schweiz keine große Bevölkerung ernähren kann. Aber sie wandern doch vor allem aus, weil sie Schweizer sind, weil sie die Energie haben, sich aus eigener Kraft in eine bessere Lage hinüber zu retten. Der Hindu wandert halt nicht aus, sondern begnügt sich mit einer kleineren Portion Reis, wenn die Bevölkerung anwächst.
Es wäre nun aber grundeinseitig, wollte man die alte und dauernde Abwanderung der palastinensischen (wie später wiederum der außerhalb Palästinas lebenden) Juden in allen Fällen als eine erzwungene ansehen. Solch ein allgemeines, durch die Jahrhunderte sich gleich bleibendes Phänomen ist gar nicht zu erklären, ohne daß man auch selbst gewollte Bewegungen neben der zwangsweisen Verpflanzung annimmt. Ob man hier einen spezifischen „Wandertrieb“ oder wenigstens eine gering entwickelte Bodenständigkeit als Grund des häufigen Ortswechsels denken will, bleibt sich gleich. Eine irgendwie bestimmte Eigenart wird man aber schon dem Volke, das so leicht von Land zu Land zog, zuerkennen müssen. Ebenso wie es ohne die Voraussetzung einer solchen Eigenart unerklärlich blieb, warum die Wanderungsziele eine so große Übereinstimmung aufweisen: warum es immer nur die großen Städte waren, in die wir schon im Altertum die Juden einziehen sehen. Herzfeld, der vielleicht die vollständigste Liste der Judenansiedlungen in der hellenistischen Zeit aufgestellt hat, weist mit Recht auf die frappante Tatsache hin, daß von den aufgezahlten Orten 52 Städte und unter diesen wieder 39 blühende Handelsstädte gewesen seien (545).
Schon diese letzten Erwägungen haben uns gezeigt, daß die jüdische Eigenart sicher nicht erst etwa in der Diaspora (oder gar erst, wie die offiziös-jüdische Geschichtschreibung annimmt, während des europäischen Mittelalters) ausgebildet worden ist, sondern daß die Diaspora selbst ein Werk dieser Eigenart ist, die also schon vorher — wenigstens im Keim — vorhanden sein mußte. Ganz dasselbe gilt aber auch von einem anderen wichtigen Symptomkomplexe, an dem wir jüdische Wesenheit studieren können:
3. von der Religion
Wenn man gesagt hat: der Jude, wie er heute sich uns darstellt, sei ein Erzeugnis seiner Religion; es sei ersichtlich, wie sehr der Jude erst zum „Judent gemacht worden, künstlich gemacht (sozusagen), und zwar durch die bewußte, von berechnende Politik einzelner Kreise und einzelner Männer, und im Gegensatz zu jeder „organischen Entwicklung„, s0 gebe ich das gewiß zu, und meine eigenen Darlegungen in dem Kapitel, das die jüdische Religion behandelt, haben den Zweck gehabt, den großen Einfluß aufzudecken, den die jüdische Religion insbesondere auf das wirtschaftliche Verhalten der Juden ausgeübt hat. Aber: ich möchte doch hier jener Chamberlainschen Auffassung gegenüber mit Entschiedenheit betonen: daß jene Religion selber in ihrer ganzen Absonderlichkeit nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht eine bestimmte Eigenart sie getragen hätte. Daß jene einzelnen Männer und einzelnen Kreise so wundersame Gedankengebilde erzeugen konnten, setzt doch bei ihnen eine geistige Eigenart voraus, und daß sich das ganze Volk von ihren Lehren gefangen nehmen ließ, sie nicht nur äußerlich, sondern mit tiefer Inbrunst in seinem Innersten anerkannte: auch das ist doch nicht denkbar ohne die Annahme, daß die Keime, die Anlagen zu der später erst freilich ausgeprägten Eigenart im Volke schlummerten, Wir können uns heute doch nicht mehr von der Anschauung freimachen, daß jedes Volk diejenige Religion auf die Dauer hat, die seinem Wesen entspricht (und daß es eine andere Religion solange umgestaltet, bis sie ihm angepaßt ist).
Man wird also, denke ich, ohne Bedenken aus der Eigenart der jüdischen Religion auf die volkliche Eigenart der Juden zurückschließen dürfen. Und eine ganze Reihe der heute wahrnehmbaren Züge lassen sich damit in sehr frühe Zeit hinauf verlegen, mindestens in die Zeit bald nach dem babylonischen Exil. Daß ich dabei an den Inhalt der Legenden dachte und etwa nach Art der Verfasser antisemitischer Katechismen aus der zum Teil recht bedenklichen Isac-Esau-Jakob-Erzählung und ihren unterschiedlichen Schwindeleien eine „Neigung des jüdischen Volkes zu betrügerischer Handlungsweise“ ableitete, wird man mir hoffentlich nicht zutrauen. Schwindeleien gehören zu dem eisernen Bestande aller Mythologien, scheint es. Wenn wir unsere Blicke auf den Olymp oder nach Walhall richten, sehen wir dort selbst die Götter sich gegenseitig auf die allerniederträchtigste Weise beschwindeln, wie es die jüdischen Erzväter gar nicht besser gekonnt hätten. Nein: ich denke an die Grundzüge des jüdischen Religionssystems, wie ich sie dargelegt habe, und finde, daß sie auch die Grundzüge des jüdischen Wesens enthalten, das vor allem Intellektualismus, Rationalismus, Teleologismus beiden gemein sind, daß wir in ihnen also Eigenarten des jüdischen Volkes erblicken müssen, die vor der Ausbildung seines Religionssystems (ich wiederhole: im Keime wenigstens) vorhanden sein mußten.
Wenn ich nunmehr als ein Symptom für die Konstanz jüdischen Wesens
4. die auffallende Gleichheit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit
durch fast alle Jahrhunderte der Geschichte aufzuführen wage, so setze ich mich damit in einen Gegensatz mit den herrschenden Meinungen. Und zwar nicht nur mit derjenigen Ansicht, die einen Wandel der wirtschaftlichen Tätigkeit der Juden im Verlauf der Jahrhunderte annimmt, sondern auch mit derjenigen, welche die auch von mir behauptete Gleichheit gelten läßt deshalb, weil ich eine andere wirtschaftliche Tätigkeit in der jüdischen Geschichte sich wiederholen sehe als die bisherige Meinung glaubte.
Dieses aber ist der heutige Stand des Wissens (und Glaubens!) vom Werdegang der jüdischen Wirtschaftsgeschichte.
Diejenige Auffassung, die man als die assimilationsjüdisch-offiziöse bezeichnen kann, die aber auch von vielen nationalgesinnten Juden vertreten wird, und die, soviel ich sehe, auf Heinrich Heine zurückgeht, ist etwa diese: die Juden sind von Haus aus ein ackerbautreibendes Volk; auch in der Diaspora (selbst noch nach der Zerstörung des Tempels) widmen sie sich dem Ackerbau und meiden alle anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten. Da ereignet sich etwa im 6. oder 7. Jahrhundert nach Christi Geburt, daß sie gezwungen werden, ihren Landbesitz zu verkaufen. Sie müssen sich nun wohl oder übel nach neuen Erwerbsquellen umschen und wählen den Warenhandel als Ersatz für die ihnen versperrte Landwirtschaft. Ein halbes Jahrtausend etwa betätigen sie sich als Warenkaufleute. Da trickt sie abermals ein vernichtender Schlag: durch die in den Kreuzzügen angefachte Bewegung gegen die Juden wird die Stimmung auch in Kaufmannskreisen eine judenfeindliche; die nationalen Kaufmannschaften, die inzwischen erstarkt sind und sich zu Verbänden zusammengetan haben, schließen die Juden vom Markte aus, den sie für ihre Korporationen monopolisieren. Die Juden, abermals ihrer Erwerbsquellen beraubt, sind abermals, genötigt, sich eine neue zu erschließen oder richtiger: die einzige zu wählen, die ihnen überhaupt noch offen steht: sie werden Geldleiher und bald privilegierte Geldleiher infolge der sie begünstigenden Zins- und Wuchergesetze.
Nach einer anderen Ansicht, die namentlich unter den nichtjüdischen Historikern, aber doch auch bei jüdischen Geschichtschreibern (wie z. B. Herzfeld) verbreitet ist, sind die Juden ein von Haus aus dem (Waren-Handel zugeneigtes und ergebenes Volk, also nicht eigentlich ein ackerbauendes, sondern ein „Handelsvolk“ das sich, wo es immer nur konnte, dem Handel zugewandt hat: seit Salomos Zeiten durch alle Epochen der palästinenssischen Geschichte und durch alle Wandlungen der Diaspora hindurch bis auf unsere Tage.
Beide Auffassungen, wie gesagt, halte ich für falsch, mindestens für einseitig, und versuche das durch einen Überblick über den Verlauf der jüdischen Wirtschaftsgeschichte zu erweisen.
Das Bild, das uns die Wirtschaft des jüdischen Volkes, seit der Königszeit bis zum Ende der nationalen Selbständigkeit und wohl bis zur Kodifikation des Talmud darbietet, ist das einer wesentlich sich selbst genügenden Volkswirtschaft, die Überschüsse des Bodens an das Ausland abgibt und deren einzelne Wirtschaften entweder ebenfalls ihren gesamten Bedarf selbst erzeugen oder durch einfachen Güteraustausch miteinander verbunden sind. Die Organisationsstypen, denen wir begegnen, sind also: Eigenwirtschaft mit angegliedertem Lohnwerk, erweiterte Eigenwirtschaft (Fronhofwirtschaft) und Handwerk. Wo sie vorherrschen, ist eine rege Handelstätigkeit, ist vor allem ein berufsmäßiger Handel in enge Schranken gebannt. Und wenn man namentlich in der Königszeit (später soll der Handel wieder abgenommen haben!) Palästina von Kaufleuten aller Art erfüllt sieht, so beruht das offenbar auf einer Verkennung der Salomonischen Wirtschaft, die ganz deutlich sich als ein System großer Fronhofwirtschaften darstellt (nach Art etwa der Villen Karls des Großen) und natürlich beträchtliche Güterbewegungen notwendig machte, die aber ganz und gar nichts mit „Warenhandel“ zu tun hatte.
„Und die Amtleute — wir würden genauer sagen: Meier = villici — die über Salomos Geschäfte waren, deren waren 550. Und Salomo machte auch Schiffe zu Ezeon-Geber, die bei Eloth liegt. Und Hiram sandte seine Knechte im Schiff, die gute Schiffsleute und auf dem Meere erfahren waren, mit den Knechten Salomos. Und kamen gen Ophir und holten daselbst 420 Ztr. (Talente) Gold und brachten es dem König“ (1. Reg. c. 9).
„Und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten und allerlei Ware; und die Kaufleute des Königs kauften dieselbige Ware“ (1. Reg. c. 10). Diese und ähnliche Stellen, aus denen man rege „internationale Handelsbeziehungen“ sogar eine „Monopolisierung des Handels“ herausgelesen hat, erklären sich zwanglos, wenn man sich die kaiserliche Haushaltung als Fronhofwirtschaft großen Stiles vorstellt, die ihre Amtmänner mit eigenen Schiffen (in Begleitung anderer großer Fronhofbesitzer) in die Fremde schickte, um für den eigenen Bedarf kauf- oder tausch- oder zwangs- oder geschenkweise) Güter herbeizuholen. Die durchaus eigenwirtschaftliche Struktur der Königswirtschaft erscheint auch besonders deutlich, wo uns der Tempelbau beschrieben wird: Salomo sendet zu Hiram, dem König von Tyros und läßt ihm sagen:
„So sende mir nun einen weisen Mann, zu arbeiten mit Gold, Silber, Erz, Eisen, Scharlachen, Rosinrot, gelber Seide. Und sende mir Zedern Tannen und Ebenholz vom Libanon; denn ich weiß, daß deine Knechte das Holz zu hauen wissen auf dem Libanon. Und siehe meine Knechte sollen mit deiner Knechten sein. Und siehe, ich will den Zimmerleuten deiner Knechte, die das Holz hauen, 20000 Kor gestoßenen Weizen und 20000 Kor Gerste und 20000 Bath Weins und 20 000 Bath Öls geben“ (2. Chr. 2. 7ff.).
Ebenso paßt es durchaus in das Bild einer großen Fronhoforganisation hinein (und beweist gar nichts für eine rege Handelstätigkeit), wenn es (2. Chr. 8, 4) heißt: Salomo baute Thadmor in die Wiste und alle Kornstädte (Magazine), die er baute in Hemath.
(Wie aus dem Cap. de villis abgeschrieben, mutet 1. Sam. 8,11 ff. an.)
Aber auch keine einzige der Quellenstellen, aus denen man für eine spätere Zeit auf „ausgedehnten Handel“ glaubt schließen zu können, läßt diese Deutung zu. (Herzfeld, der diese Dinge am gründlichsten bearbeitet hat, begeht außer den Interpretationsfehlern noch viele Irrtümer bei der Datierung der Quellen: er hält im wesentlichen an der vorkritischen Chronologie der einzelnen Bibelbücher fest und verlegt deshalb die meisten Quellen in die vorexilische Zeit.)
Was wir über die reichen Exulanten aus der Bibel erfahren, (Esra 1, 4. 6; Zach. 6. 10—11), läßt uns doch ganz im ungewissen über ihre berufliche Tätigkeit und rechtfertigt doch sicher nicht den Schluß (Graetz), sie seien durch „Handelsbetrieb“ reich geworden. (Eher lassen schon die Keilschrifturkunden aus Nippur darauf schließen, daß es jüdische Großhändler in Babylonien gegeben habe.) Aus Ezech, 26, 2 Handelsneid der Phönizier herauszulesen und darauf die Hypothese einer vorexilischen „Handelsblüte im Großen“ aufzubauen, erscheint mir doch allzu kühn.
Wie vorsichtig man sein muß, wenn man aus einer Bemerkung auf die Existenz eines berufsmaligen Handels schließen will, beweist die oft verwertete Stelle Prov. 7, 19. 20, wo uns von den Machenschaften der ehebrecherischen Gattin berichtet wird: „Sprach das buhlerische Weib zum närrischen Jüngling: Komm, der Mann ist nicht daheim, er ist einen fernen Weg gezogen. Er hat den Geldsack mit sich genommen und wird erst auf das Fest wieder heimkommen„. Kaufmann? Möglich. Aber ebenso gut konnte es ein Bauer sein, der seinen Pachtzins etwa an den entfernt wohnenden Villicus abfahren und bei dieser Gelegenheit ein Paar Ochsen einkaufen wollte.
Dagegen bezeugen andere Stellen ganz deutlich auch noch für die spätere Zeit das Dasein fronhofartiger Organisationen. Wenn etwa Nehemia (Neh. 2, 8) für die Neuerbauung Jerusalems Briefe an Assaph, den Holzfürsten des Königs bekommt, daß er Holz gebe (oder wie De Wette übersetzt: „den Aufseher des kgl. Waldes„). Während wiederum andere Stellen, z. B. Lev. 19, 35. 36, wo sich die oft herbeigezogenen Vorschriften des P über rechte Wagen, Maße und Gewichte finden, zum mindesten nichts gegen die Annahme einer vorwiegend eigenwirtschaftlichen Organisation beweisen.
Natürlich gab es immer schon einen Güteraustausch und wohl auch schon zur Königszeit einen berufsmäßigen „Kaufmannsstand„, richtiger „Krämerstand„. Wir erfahren von ihm, wenn der besiegte König Benhadad dem König Ahàb anbietet, ihm Gassen (für Krämer) in Damaskus zu bauen, wie sein Vater in Samaria getan habe (1. Reg. 20, 34 siehe auch 1. Reg. 10, 14. 25), oder wenn es ausdrücklich erwähnt wird, daß in dem neuen Jerusalem „zwischen dem Saal an der Ecke zum Schaftor die Goldschmiede und Krämer bauten“ (Neh. 3. 32). Wieso uns aber diese Mitteilung zeigen soll, „daß es in Jerusalem angesehene Kaufmannsgilden gab“ (Bertholet), ist nicht einzusehen. Man kann doch vielmehr die kleinen Budenbesitzer am Schaftor mit Händen greifen.
Aber es gab wohl schon frühzeitig auch einen internationalen Güteraustausch auf dem Wege des Handels und vermutlich auch berufsmäßige „Großhändler“, die diesen Austausch vermittelten: das heißt im wesentlichen die überschüssigen Bodenerzeugnisse Palästinas wegholten und dafür Luxusware (?) hereinbrachten (546). „Juda und das Land Israel haben auch mit dir — Tyros – gehandelt und haben dir Weizen von Minnith und Balsam und Honig und Öl und Mastix auf deine Märkte gebracht“. Aber hier begegnen wir nun der merkwürdigen Tatsache, daß dieser wenige Handel größeren Stils nicht in den Händen jüdischer, sondern fremder Kaufleute lag, also vom Standpunkt der Juden aus „Passivhandel“ war. „Es wohnten auch Syrer darinnen (in Jerusalem), die brachten Fische und allerlei Ware“. Wir sehen Karawanen durch Palästina ziehen: aber sie werden geführt nicht von Juden, sondern von Midianitern, Sabäern, Dedanitern, Nabatäern, Kedarenern und anderen Völkern (547). Noch Exechiel (26, 2) nennt Jerusalem „die Türe der Völker“, offenbar in Gedanken namentlich der Südvölker nach Tyros und Sydon. Selbst der Hausierhandel liegt zur Zeit der Proverbien noch in den Händen der Kanaaniter. Und wenn schon die Juden nicht einmal den Handel im eigenen Lande an sich zu ziehen gewußt hatten, so ist es nur natürlich, daß sie auch auf dem „Weltmarkte“ als Vertreter der internationalen Handelsbeziehungen in fremden Ländern während des Altertums keine besonders hervorragende Rolle gespielt haben. Die „internationalen Kaufleute“ des Altertums sind die Phönikier, die Syrer, die Griechen, aber nicht die Juden (548). „Ausdrückliche Zeugnisse, daß die jüdische Emigration vorzugsweise eine handeltreibende war, fehlen fast ganz“ (549).
Angesichts so vieler übereinstimmender Zeugnisse sehe ich gar keinen Grund ein, weshalb wir die bekannte Stelle beim Josephus (contra Apion 1, 12) – „wir bewohnen kein Land am Meere und erfreuen uns nicht des Seehandels oder sonstigen Handels“ für die Judenschaft der damaligen Zeit (mindestens für die noch ansässigen Juden Palästinas) als tendenziöse Übertreibung ansehen sollen. Die Aussage entspricht offenbar den Tatsachen.
Und auch die folgenden Jahrhunderte brachten keine wesentliche Wandlung dieses Zustandes. Auch im Talmud überwiegen die Aussprüche, die darauf schließen lassen, daß die handwerksmäßigeigen wirtschaftliche Organisation des jüdischen Wirtschaftslebens, wenigstens im Orient, unverändert weiter bestand und daß von einer vorwiegenden „Handelstätigkeit“ gar keine Rede war. Zwar hören wir den Mann selig preisen, der ein „Gewürzkrämer“ werden kann es und nicht schwere Handwerkerarbeit zu verrichten braucht. Aber das ist doch eben das Los des Budikers, nicht des „Kaufmannes“. Dem „Handel“, zumal dem überseeischen, ist die Stimmung der Rabbinen nicht günstig. Manche verdammen geradezu alle marktmäßige Organisation und preisen die Eigenwirtschaft pur et simple:
„R. Achai b. Joschiah sagte: Wem gleicht der, welcher Frucht vom Markte kauft? Einem Kinde, dem die Mutter gestorben ist; man sucht mit ihm die Türen der Mütter auf, die ihre Kinder stillen und das Kind wird nicht gesättigt. Wer Brot vom Markte kauft, gleicht dem, der sich selbst ein Grab gräbt, in dem er begraben wird (551),.“
Raab (Abba) — 175 bis 247 — schärft seinem zweiten Sohne ein: lieber ein kleines Maß vom Felde als ein großes vom Söller (Warenlager) (552). Die Rabbanen lehrten: an vier Perudas ist niemals ein Zeichen des Segens zu finden: „am Schreiberdienst, an der Dolmetschgebühr, am Verdienst aus Waisengeld und am Verdienst aus überseeischen Geschäften“. Für dieses wird als Grund angeführt: „weil nicht an jedem Tage ein Wunder geschieht“ (553).
Und wie gestalteten sich die Dinge nun im Okzident: Auch hier dürfen wir uns die „Handelstätigkeit“ der Juden ganz und gar nicht großzügig vorstellen. Vielmehr erscheint der Jude (neben den „Syrer„) während der römischen Kaiserzeit und dann während der frühmittelalterlichen Jahrhunderte, wo er als Händler auftritt, als recht bescheidener, kleiner Packenträger, der den „königlichen Kaufleuten“ des kaiserlichen Roms störend zwischen die Beine lief, wie der kleine polnische Handelsmann des 17. und 18. Jahrhunderts den Kaufmannschaften unserer Länder. Alles was wir über jüdischen Warenhandel während des frühen Mittelalters erfahren, paßt in dieses Bild des kleinen Packenträgers sehr gut hinein. Und nichts berechtigt für diese Jahrhunderte, die Juden als ein „Handelsvolk“ anzusprechen, das sie zu keiner Zeit gewesen sind, in der der „Handel“ — wenigstens der interlokale und internationale Handel — den Charakter halb räuberischen, halb abenteuerlichen Unternehmens trug: also bis in die allerletzte Leit hinein.
Also — so wird man vielleicht schließen — wenn die Juden kein „Handelsvolk“ waren, so haben die Vertreter der anderen Ansicht wenigstens damit Recht, das sie ein „ackerbautreibendes“ Volk waren. Darauf ist zu erwidern: gewiß, in dem Sinne, wie es oben ausgeführt wurde, daß die jüdische Volkswirtschaft während des ganzen Altertums und tief in das Mittelalter hinein ein eigenwirtschaftliches Gepräge trug (die Ausdrücke „Handelsvolk“, „Ackerbauvolk“ usw., sind ihrer Unbestimmtheit wegen zu vermeiden; ich komme auf diesen Punkt noch zu sprechen) Ganz und gar nicht aber in dem anderen Sinn: als sei den Juden diejenige wirtschaftliche Tätigkeit, der man sie später fast ausschließlich obliegen sieht, und in die sie (nach assimilationsjüdisch-offiziöser Auffassung) wider ihren Willen hineingedrängt sein sollen: als sei die Geldleihe ihnen damals fremd gewesen. Im Gegenteil, und das ist die Tatsache, auf deren Feststellung ich das entscheidende Gewicht lege: seit wir eine jüdische Wirtschaftsgeschichte kennen, und solange wir sie durch die Jahrhunderte verfolgen können; immer nimmt die Geldleihe in dem volkswirtschaftlichen Leben einen ganz großen, einen erstaunlich großen Raum ein. Sie begleitet die jüdische Volksgemeinschaft in allen Phasen ihrer Entwicklung: sie ist bei ihr in den Zeiten der nationalen Selbständigkeit, ebenso wie in der Diaspora; sie schmiegt sich ebenso leicht (und wohl besonders gern) der bäuerlichen Eigenwirtschaft, wie allen andern Wirtschaftsweisen an. Und es sind Juden, die wir als Gläubiger finden. So wenigstens seit ihrer Rückkehr aus Ägypten, Während sie dort die Schuldner der Ägypter gewesen zu sein scheinen: sie nehmen bekanntlich nach dem offiziellen Bericht, als sie aus Ägypten fliehen, die Darlehnssummen, die ihnen die Agypter geliehen hatten, mit sich: „Und ich will diesem Volke Gnade geben vor den Ägyptern, das, wenn Ihr ausziehet, nicht leer ausgehet“ (Ex. 3, 21.) „Dazu hatte der Herr dem Volk Gnade gegeben vor den Ägyptern, daß sie ihnen leiheten; und entwandten es den Agyptern“ (Ex. 12, 36.) Aber das wurde dann von Grund aus anders; es verkehrte sich in sein Gegenteil: Israel wurde der Gläubiger, und die fremden Völker wurden seine Schuldner. Sodaß sich der wunderbare Segen erfüllte, den man als Geleitwort jeder jüdischen Wirtschaftsgeschichte voranstellen sollte, jener wunderbare Segen, in dem das ganze Schicksal des jüdischen Volkes wie in einem Sinnspruche ausgedrückt ist, das Wort Jahves: „Der Herr dein Gott wird dich segnen, wie er dir geredet hat. So wirst du vielen Völkern leihen und wirst von niemand borgen“. (Deut. 15, 6.) Bertholet macht zu dieser Stelle in seinem Deuteronomion-Kommentar die Anmerkung (554): „weist auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund einer Periode hin, in der Israel als Handelsvolk über alle Welt verbreitet ist und tatsächlich durch seine Geldgeschäfte eine Macht auf Erden war„. Bertholet sieht (wie ich seiner freundlichen brieflichen Mitteilung entnehme) in Deuteronomion 15, 4—6 eine späte Einschaltung und würde, „gerade weil die Worte eine so große Verbreitung Israels vorauszusetzen scheinen, am ehesten in die griechische Zeit (also nach Alexander d. Gr.), hinabzugehen geneigt sein“. (Übrigens stimmt jetzt Marti in Kautzschs Bibelübersetzung 3 S. 266 mit dieser Ansicht überein.)
Daß ich selbst für diese späte Zeit noch nicht recht an das über alle Welt verbreitete Handelsvolk der Juden glauben kann, habe ich schon gesagt. Um mich zu vergewissern, daß ich nicht etwa wichtige Quellenstellen übersehen habe, fragte ich bei Professor Bertholet an, worauf er sein Urteil gründe, und er verwies mich auf Prov. 7. 19f.; 12, 11; 13, 11; 20, 21; 23, 4f.; 24, 27; 28, 19, 20, 22. Jesus Sirach 26,29—27,2.
Ich habe diese Stellen, die meist von den Gefahren des Reichtums handeln, schon in anderem Zusammenhange besprochen und finde bei genauer Prüfung, das keine einzige auf eine Handelstätigkeit größeren Stiles hinweist. Daß Prov. 7 19. auf einen reisenden Kaufmann gedeutet werden kann (aber nicht braucht), habe ich auch schon ausgeführt. Wenn wir von Tobit (auf den mich Professor Bertholet auch aufmerksam macht) erfahren, daß er des Königs Enemanassars „Einkäufer“ (xxxxxxxx) war und als solcher ein gutes Einkommen bezog, so läßt dieses Verhältnis gerade wieder auf fronhofartige Organisation schließen, die den berufsmäßigen Handler in sich selber nicht kennt. Der jüdische Kaufmann am Königshof von Adiabene, Ananias, den Josephus erwähnt, kann Händler, kann aber auch Hofjude gewesen sein. Wie ich denn natürlich nicht leugne, daß die Juden jederzeit namentlich in der Diaspora auch (internationalen) Handel getrieben haben. Nur daß dieser ihnen charakteristisch gewesen sei, glaube ich nicht. Charakteristisch war vielmehr das Leigeschäft. Und für dieses wird gelten für jene Zeit, in die Deut. 15, 6 zu setzen ist, was Bertholet behauptet: daß damals Israel schon durch seine Geldgeschäfte eine Macht auf Erden war. Auch daß er in diesem Sinne das Strabocitat (Jos. Ant. XIV. 7, 2) deutet: „xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx’xxxxx„, scheint mir durchaus berechtigt. Denn es wäre schwer zu sagen, worauf sich sonst das xxxxxxxxxx beziehen sollte, wenn nicht auf die Geldmacht der Juden, da ein anderes Herrschaftsverhältnis sich schwer bei ihnen ausfindig machen läßt.
Die ältesten urkundlichen Belege für den hochentwickelten Leihverkehr im alten Israel enthält wohl die Strafrede Nehemias, die in ihren Hauptstellen (in De Wettescher Übersetzung, die Lutherische Übersetzung ist voller Ungenauigkeiten und in den Hauptpunkten geradezu ohne Sinn) also lautet:
„Und es erhob sich ein großes Geschrei des Volkes und der Weiber gegen ihre Brüder, die Juden. Und es waren, welche sprachen: Unsre Söhne und unsre Töchter, unser sind viel: so laßt uns Getreide schaffen und essen, daß wir leben.
„Und es waren, welche sprachen: Wir müssen unsre Felder und unsre Weinberge und unsre Häuser verpfänden, daß wir Getreide schaffen für den Hunger
„Und es waren, welche sprachen: Wir haben Geld entlehnet, zu den Steuern für den König auf unsre Felder und unsre Weinberge.
„Und doch ist es wie unsrer Brüder Leib unser Leib und wie ihre Länder unsre Länder, Und siehe, wir müssen unsre Söhne und unsre Töchter der Knechtschaft unterwerfen und wir haben kein Vermögen in unsern Händen und unsre Felder und unsre Weinberge gehören andern.
„Da wurd ich sehr zornig, als ich ihr Geschrei hörte und diese Rede. Und mein Herz war ratlos in mir und ich haderte mit den Edeln und Vorstehern und sprach zu ihnen: Wucher treibet Ihr, einer mit seinem Bruder? Gebet ihnen doch zurück heute ihre Felder, ihre Weinberge, ihre Ölgärten und ihre Häuser und den Hundertsten vom Gelde und vom Getreide und von dem Öl, den Ihr ihnen vom Zins genommen.“ (Neh. 6, 5).
Das Bild, das hier Nehemia entwirft, läßt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: das Volk geteilt in zwei Hälften, eine reiche Oberschicht, die sich mit Geldleihen beschäftigt, und eine ausgewucherte Masse Landarbeiter. Die „fremden Völker“ sind hier einstweilen die (wahrscheinlich) stammesfremden Volksgenossen im eigenen Lande.
Dieser einheimische Kreditverkehr hat sich nun offenbar während der ganzen jüdischen Geschichte in Palästina und Babylonien (trotz Nehemia und anderen Reformern!) unvermindert erhalten. Dafür sind die Talmudtraktate ein bündiger Beweis. Denn in ihnen — namentlich natürlich in den verschiedenen Babas — spielt nächst dem Thorastudium nichts eine so große Rolle wie das Leihgeschäft. Die Vorstellungswelt der Rabbanen, (die wohl in sehr vielen Fällen die Hauptgeldgeber waren): die Entscheidung des Rabina (des letzten Amoräers, 448-556) in Sachen des Fremdenzinses (B. m. fol. 70b) klingt geradezu wie die Erklärung eines Wuchermonopols für die Rabbanen: ist ausgefüllt mit Geldgeschäften. Beispiele von Darlehnsgeschäften, Zinsformen usw. sind außerordentlich häufig; ebenso Diskussionen über Geld und Geldleiheprobleme. Jedem unbefangenen (und wirtschaftlicher Kenntnisse nicht ganz baren) Leser ergibt sich aus der Lektüre des Talmud der deutliche Eindruck: in dieser Welt wird viel Geld geliehen.
In der Diaspora nimmt dann das Geldleihegeschaft offenbar erst recht seinen Aufschwung. Wie weit geregelt der Geldverkehr der Juden in der ägyptischen Diaspora schon vier oder fünf Jahrhunderte vor der christlichen Zeit war, zeigt der Oxforder Papyrus (Ms. Aram c 1 [P] (555)) ….. Sohn des Jatma ……..
Du hast mir Geld gegeben /……. 1000 Segel Silber. Und ich will an Zinsen zahlen 2 hallur Silber / auf einen Segel Silber für den Monat bis zu dem Tage, an dem ich dir das Geld zurückbezahle. Die Zinsen / für dein Geld sollen also 2000 hallur auf den Monat betragen. Zahle ich für einen Monat keine / Zinsen, so sollen sie zum Kapital geschlagen und gleichfalls verzinst werden. Ich will dir Monat für Monat bezahlen / von meinem Gehalte, das man mir aus dem Schatze auszahlt und du schreibst mir eine Quittung (?) über das ganze / Geld und die Zinsen, die ich dir zahlen werde. Erstatte ich dir dein ganzes / Geld nicht bis zum Monat Rot des Jahres ……. zurück, so soll verdoppelt werden (?) dein Geld / und die Zinsen, die bei mir zurückbleiben und es soll Monat für Monat mir zur Last verzinst werden / bis zu dem Tage, an dem ich es dir zurückzahle / Zeugen“ usw. usw.
In der hellenistischen und kaiserlich römischen Zeit begegnen uns die reichen Juden als die Geldgeber der Könige, und die ärmeren liehen in den Niederungen des Volkes. Jedenfalls ist damals in der römischen Welt schon von den jüdischen „Schachern“ die Rede (556).
Ebenso standen sie bereits in vorislamitischer Zeit bei den Arabern, denen sie gegen Zins liehen, in dem Rufe, daß ihnen „Schacher und Wucher“ im Blute lägen (557).
Und auch in den westeuropäischen Kulturkreis treten viele wohl von vornherein als Geldgeber ein. Wir hatten sie schon bei den Merowingischen Königen als Geschäftsträger und Finanzverwalter (das heißt doch eben wesentlich als Gläubiger) gefunden (558).
In Spanien aber, wo sie am freiesten sich betätigen konnten, ist frühzeitig das Volk ihnen verschuldet. Lange bevor es in den übrigen Staaten so etwas wie eine Juden (= Wucher) frage gab, sehen wir in Kastilien die Gesetzgebung sich mit dem Problem der Judenschulden befassen in einer Weise, die nicht im Zweifel läßt, daß das Problem bereits große praktische Bedeutung erlangt hatte (559).
Daß „seit den Kreuzzügen“ die Geldleihe den Hauptberuf der Juden bildet, wird von niemand bestritten. Sodaß wir also feststellen können: seitdem wir etwas vom jüdischen Wirtschaftsleben wissen, sehen wir in ihm eine hervorragende Rolle die Geldleihe spielen.
Es wäre nun wirklich an der Zeit, daß die Mähr verschwände: die Juden seien während des europäischen Mittelalters —im wesentlichen erst „seit den Kreuzzügen“ — in das Geldleihgeschäft hineingezwungen worden, weil ihnen alle Berufe verschlossen gewesen seien. Die zweitausendjährige Geschichte eines jüdischen Leihverkehrs bis zum Mittelalter beweist doch wahrhaftig schon deutlich genug die Irrigkeit jener Geschichtskonstruktion. Aber selbst für das europäische Mittelalter und für die neuere Zeit ist noch nicht einmal durchgängig wahr, was die offiziöse Geschichtschreibung behauptet. Auch da war den Juden keineswegs überall der Weg zu allen anderen Berufen außer dem „Wucher“ versperrt, und sie liehen doch mit Vorliebe auf Pfänder aus. Das hat Bücher z. B. für Frankfurt a. M. nachgewiesen, und es läßt sich für andere Orte und Länder ebenso feststellen. Ja — was noch mehr für die natürliche Tendenz der Juden zum Geldleihegeschafft spricht — wir erleben es im Mittelalter und später, daß die Regierungen sich geradezu bemühen, die Juden anderen Berufszweigen zuzuführen, aber vergeblich. So in England unter Eduard I. (560), s0 im Pesenschen noch im 18. Jahrhundert (561), wo die Behörden durch Prämien oder andere Mittel die Juden zum Berufswechsel zu bestimmen suchten. Trotz dessen und trotzdem sie dort Handwerker und Bauern werden konnten wie alle anderen, finden wir 1797 in den Städten von Südpreußen 4164 jüdische Handwerker neben 11—12 000 jüdischen Handelsleuten (neben nur 17—18000 christlichen bei nur 5—6 % jüdischer Bevölkerung).
Nun könnte man vielleicht einwenden: Das „Wuchern“ (die „Geldleihe“) brauche, auch wenn sie ganz freiwillig geübt wird, gar nicht einer besonderen volklichen Anlage zu entspringen, da „allgemein-menschliche Gründe — zur Erklärung — genug bereit liegen.
Überall, wo in einem Volke Leute mit großem Vermögen, neben anderen Leuten leben, die aus irgendwelchen Gründen (sei es zu Konsumtion, sei es zu produktiven Zwecken) Geld nötig haben, wofern nur die primitivsten Bedingungen für die ordnungsmäßige Abwicklung eines Leihverkehrs in der Rechtsordnung erfüllt sind, sind die beiden Gruppen der Bevölkerung stets in das Verhältnis von Gläubigern und Schuldnern zueinander getreten.
Ja — wo auch überhaupt nur Reiche neben Armen gewohnt haben, selbst wenn es noch nicht einmal Geld in dem Lande gab, haben diese von ihnen — dann in natura — geborgt. In den Anfängen der Kultur wohl ohne Zins zu zahlen, wo sich die beiden Gruppen noch als Genossen derselben Gemeinschaft fühlten. Später — und zwar erst im Verkehr mit Fremden – wird das zinstragende Darlehn in gewöhnlichen Gebrauchsgütern (wie Getreide, Vieh, Öl) oder in Geld zu einer ständigen Einrichtung jeder nur irgendwie besitzdifferenzierten Volkswirtschaft.
Altertum, Mittelalter und Neuzeit sind gleichmäßig angefüllt mit Leihe und „Wucher“. Und beteiligt an ihnen sind Angehörige der verschiedensten Volksstämme und der verschiedensten Religionen. Für das Altertum braucht nur an die großen Agrarreformen in Griechenland und Rom erinnert zu werden, die uns deutlich zeigen, daß es in diesen Ländern zu bestimmten Zeiten genau so aussah wie in Palästina zur Zeit des Nehemia. Mittelpunkte des Geldleiheverkehrs waren im Altertum die Tempel, in denen sich große Baarvorräte aufhäuften. Wenn der Tempel zu Jerusalem Geld auslieh — ob er es tat, läßt sich nicht einmal mit Sicherheit feststellen: der Talmudtraktat, der von den Tempelsteuern handelt (Sekalim), verbietet sogar ausdrücklich, daß Überschüsse (einer bestimmten Opfergabe) zu Geschäften verwendet würden — wenn der Tempel, sage ich, Geld auslieh, so tat er damit nichts anderes als was alle großen Tempel im Altertum taten. Von denen Babyloniens wissen wir, daß sie großen Geschäftshäusern glichen: der Marduktempel in Babylon, der Sonnentempel in Nippur. „Die als Zehnten zuströmenden Massen von Naturalien mußten, soweit sie nicht zu Opferzwecken, zur Speisung und Besoldung einer vielhundertköpfigen Priester- und Dienerschaft Verwendung fanden, nutzbringend angelegt werden, mittels Ankaufs von Häusern und Grundstücken, die dann vermietet, bezw. verpachtet wurden, mittels Verkaufs von Getreide und Datteln, aber vor allem Gelddarlehen, so daß die Tempel schließlich Bankhäuser wurden (562).
Dasselbe wird uns von dem Tempel zu Delphi berichtet (563), von Delos, Ephesos, Samos.
Ebenso bekannt ist es, daß im Mittelalter die christlichen Kirchen, Klöster, Stifte, Ordenshäuser ebenfalls Mittelpunkte eines lebhaften Geldleiheverkehrs waren (trotz Zinsverbotes!).
Und wenn heute der Marschenbauer ein paar Hundert oder Tausend blanke Taler erübrigt hat, so weiß er nichts besseres damit anzufangen, als sie gegen „Wucherzinsen“ seinem bedürftigen Nachbarn auf der Geest als Darlehn zu geben.
Tinsen von ausgeliehenem Gelde zu beziehen, ist ein zu reizvolles und zu leichtes Mittel, sein Einkommen zu vergrößern, als daß es nicht von jedermann, der dazu imstande ist, gern angewandt werden sollte. Man braucht dazu wahrhaftig kein Jude zu sein. Zeiten akut gesteigerten Leiheverkehrs pflegen diejenigen zu sein, in denen eine bis dahin wesentlich eigenwirtschaftlich organisierte Volkswirtschaft durch äußere Gründe in die Tauschwirtschaft hineingedrängt wird, namentlich wenn selbstgenügsame Bauern durch rasche Steigerung der Zinsen und Steuern zu großen Geldausgaben genötigt werden, während sie noch wenig verkaufen; oder wenn der Grundadel zu städtischer Lebensweise übergehen will: dann fehlen Baarmittel, die auf dem Wege der Anleihe beschafft werden müssen. Das sind dann die Zeiten, in denen „Kreditkrisen“ (und in der neueren europäischen Geschichte Judenverfolgungen) auszubrechen pflegen.
Also, jeder der’s kann, „wuchert“ mit Freuden. Aber wenn nun vielleicht das „Mögen“ eine sehr weit verbreitete Erscheinung ist: ist dasselbe der Fall mit dem „Können„? Das führt mich zu einer neuen Erwägung:
Daß die Konstanz jüdischen Wesens deutlich erkannt werden kann aus ihrer
5. Begabung für Geldgeschäfte
Man weiß, daß die Stadtherren und Stadtverwaltungen im Mittelalter die Juden oft genug geradezu anflehten: sie möchten doch ja in die Stadt „wuchern“ kommen. Sie sollten alle nur erdenklichen Vergünstigungen genießen. Augefangen von dem Bischof von Speier, der es für opportun erachtete, um seiner Stadt ein gewisses Cachet zu verleihen, eine Anzahl jüdischer Geldleute hereinzusetzen. Bis zu den förmlichen Verträgen, die die Stadtgemeinden Italiens noch im 15. und 16. Jahrhundert mit den angesehensten jüdischen „Wucherern“ abschlossen, damit diese eine Leibbank errichteten oder sonstwie auf Pfänder liehen.
Nach Florenz wird in den Jahren 1436, 1437 eine Anzahl jüdischer Pfandleiher von der Stadtverwaltung gezogen, um der Geldnot der ärmeren Bevölkerung abzuhelfen. Avv. M. Ciardemi, Banchieri ebrei in Firenze nel secolo XV e XVI. 1907.
Als die Stadt Ravenna sich der Republik Venedig anschliesen will (15. Jahrh.) und Bedingungen für ihren Anschluß stellt, verlangt sie u. a. das reiche Juden dahin geschickt werden, eine Leihbank zu eröffnen, damit der Armut der Bevölkerung gesteuert werde. Beilage bei Graetz, G. d. J. 8, 235.
„Hatte man schon in der vergangenen Periode (bis 1420) ein bedeutendes Anwachsen der Geldgeschäfte bei den römischen Juden bemerkt, so nahmen dieselben, unter der Gunst der Verhältnisse, in diesem Zeitabschnitte (1420—1550) noch einen weit größeren Aufschwung. Es war sogar in Italien Brauch geworden, daß die einzelnen Kommunen mit der Juden wegen der Verleihgeschäfte förmliche Verträge und Abmachungen abschlossen.“ Nach Theiner, Cod. dipl. 3, 335; Paul Rieger, Gesch. d. J. i. Rom (1895), 114.
Diese Vergünstigungen, die den jüdischen „Wucherern“ während des Mittelalters zuteil werden, legen die Vermutung nahe, daß doch auch irgendwie etwas persönlich Eigenartiges an diesen Juden gehaftet habe, weshalb man gerade sie und niemand anders in der Stadt als Pfandleiher haben wollte. Gewiß bevorzugte man sie, damit die Christenmenschen nicht mit der Sünde des Zinsennehmens befleckt wurden. Aber nur darum? Waren sie nicht auch die „geschickteren“ Geldmanner? Läßt sich überhaupt diese jahrhundertelange glückliche Leiherei, die immer wieder zu Reichtum führte, begreifen, ohne daß wir auch hier eine besondere Veranlagung bei denen, die sie übten, voraussetzen: Leihen ja: das kann jeder; aber erfolgreich leihen: das ist ohne bestimmte Geistes- und Charaktereigenschaften nicht denkbar.
Daß in der Tat hier bei den Juden das Geldverleihen mehr als das dilettantische Hingeben eines Darlehns und Hereinnehmen einer Zinssumme bedeutete, daß das Gelderleihen von den Juden zu einer Kunst ausgebildet worden war, daß sie wahrscheinlich die Begründer (sicher aber die Verwahrer) einer hochentwickelten Leihtechnik während all der Jahrhunderte sind, das lehrt auf das klarste ein Studium der Talmudtraktate, die von diesen weltlichen Dingen handeln.
Es wäre wirklich an der Zeit — und ich hoffe, daß dieses Buch eine Anregung dazu bieten wird —, daß ein nationalökonomisch geschulter Kopf einmal die wirtschaftswissenschaftlich bedeutsamen Teile des Talmud und der rabbinischen Literatur einer gründlichen Bearbeitung unterzöge. Hier kann und soll natürlich diese Arbeit nicht geleistet werden. Ich muß mich begnügen, auf die für eine ganz bestimmte Fragestellung wichtigen Stellen kurz hinzuweisen, damit sie ein anderer dann um so leichter finden kann. Das heißt: ich will nur die Punkte zusammenstellen, die mir für ein ganz erstaunlich hohes Maß von Vertrautheit mit ökonomischen und insonderheit kreditwirtschaftlichen Problemen zu sprechen scheinen. Wenn man die Zeit bedenkt, in der der Talmud entstanden ist (200 v. Chr. bis 500 n. Chr.) und gegen ihn alles das hält, was uns das Altertum und das Mittelalter an nationalökonomischen Einsichten hinterlassen haben, so kommt man aus der Verwunderung gar nicht heraus. Sprechen doch viele der Rabbanen, als hätten sie mindestens Ricardo und Marx gelesen, oder als wären sie ein paar Jahre als Broker auf der Stock exchange oder als Prokuristen in einer großen Spekulationsbank oder als Rechtsanwalte in Wucherprozessen tätig gewesen.
Beispiele:
- a) Genaue Kenntnis von den Edelmetallen und ihrer Beschaffenheit: „R. Hisda sagte: Es gibt 7 Arten von Gold: Gold, gutes Gold, Ophir Gold (1. Reg. 10, 11), feines Gold (ib. 5, 18), gezogenes Gold, massives Gold und Parvajin Gold“ Joma 45a (L. G. 2, 881.)
- b) Die Einsicht in das Wesen des Geldes als eines „allgemeinen Warensquivalents“ ist vollkommen entwickelt. Man unterscheidet genau die beiden Edelmetalle: ob sie zu bestimmten Zeiten vollgültiges Währungsgeld waren oder nicht. Hierfür ist auf den ganzen 4. Abschnitt der Baba mezia zu verweisen. (Der Begriff des Geldes = allgemeines Warenäquivalent wird entwickelt an dem Rechtssatze: daß der Kauf erst perfekt sei, wenn die Ware, nicht schon, wenn das Geld tradiert ist.)
- c) Vollkommen klar unterschieden werden die Kategorien des Konsumtiv und Produktivkredits (der Zins für Darlehne zu produktiven Zwecken ist gestattet, der für Konsumtivkredit unter Genossen nicht). „Wenn jemandein Feld von einem anderen für 10 Malter Weizen des Jahres (Pachtzins) pachtet (Sammter übersetzt mietet); darauf spricht er zu ihm (dem Verpachter): Borge mir 200 Sus, ich will das Feld damit (besser) bestellen und gebe dir alsdann 12 Malter das Jahr, so ist das erlaubt. Aber man darf nicht mehr geben wollen beim Mieten eines Ladens oder Schiffes? Bemerkt Rab Nachman (235—320) im Namen des Rabbah bar Abuha: Oftmals darf man beim Laden mehr geben, um dort Bilder anzubringen, oder beimSchiff, um einen Mastbaum aufzustellen. Ein Laden, um dort Bilder anzubringen — weil alsdann viele Leute dorthin kommen und er einen größeren Gewinn erzielt. Ein Schiff, um einen Mast darin aufzustellen – weil, wenn der Mastbaum (das Takelwerk) gut ist, dann gibt es mehr Verdienst, und das Schiff wird mehr wert.“ B. m. 69b (Übers. Sammter). Vgl. auch B. m. 73a.
- d) Eine unheimlich hohe Entwicklung weisen Recht und Technik der Darlehnsverträge auf. Wenn manden 4. und 5. Abschnitt der Baba mezia durchliest, bekommt man den Eindruck, als ob es sich etwa um eine Wucherenquete in Hessen vor zwanzig oder dreißig Jahren handelte: so tausendfältig sind die Kniffe und Pfiffe, diebei den Leihverträgen in Anwendung kommen, Eine hohe Technik des Leihverkehrs beweist auch die Einrichtung desProsbul, wodurch man sich bekanntlich von der Verpflichtung befreite, im Erlaßjahr auf geliehene Gelder zu verzichten, Sebiith X. Abschnitt (L. G. 1, 273 f.).
- e) Auch die Behandlung der Depotverträge ist eine merkwürdig sachkundige. „Wenn jemand Gelder bei einem Bankier aufzubewahren gibt, so darf sich dieser derselben (!),wenn sie zusammengebunden sind, nicht bedienen; sind sie aber lose, darf er sich ihrer bedienen; wenn sie nunverloren gehen, muß er dafür aufkommen. Bei einem Privatmann, so darf dieser weder ungebunden, noch lose sich derselben bedienen; gehen sie nun verloren, braucht er nicht dafür aufzukommen. Der Krämer gleicht dem Privatmann, so lehrt R. Meir (100—160); R. Jehuda (136—200) dagegen: der Krämer ist wie der Bankier anzusehen ….“ B. m. 43a (Übers. Sammter) usw.
- f) Möchte ich die starke rechnerische Begabung betonen, die sich deutlich bei den Talmudisten, aber auch schon früher bei den Juden nachweisen läßt.
Jedermann müssen die exakten Zahlenbestimmungen, schon in der älteren Literatur (von der Bibel angefangen), auffallen. Al. Moreau der Jonnés, Stat. des peuples de l’antiquité 1 (1851), 98 meint im Hinblick auf die hervorragenden Leistungen der altjüdischen Statistik: „La race…. possedait une capacité singulière: Pesprit de calcul et pour ainsi dire le gènie des nombres.“ Über die Volkszählungen in der Bibel schrieb mit fachmännischem Urteil in neuerer Zeit Max Waldstein in der Statist. Monatsschrift, Wien 1881.
Was mir aber ebensosehr, wenn nicht mehr, als diese tiefgründigen Erörterungen der Rabbanen auf eine spezifisch jüdische Begabung für das Geld und Kreditwesen schließen läßt, ist der Erfolg, mit dem sie zu allen Zeiten ihre Geschäfte betrieben haben. Dieser Erfolg findet seinen imposanten Ausdruck in der
6. Tatsache des jüdischen Reichtums.
Es läßt sich mühelos feststellen, daß, solange es eine jüdische Geschichte gibt, die Anhäufung großer Reichtümer bei einzelnen Juden ebenso wie die durchschnittlich größere Wohlhabenheit der jüdischen Bevölkerung nicht bezweifelt werden kann, und daß zu allen Zeiten und in allen Kulturen der jüdische Reichtum gleichsam sprichwörtlich gewesen ist.
Das fängt mit König Salomo an, der selbst unter den reichen orientalischen Fürsten durch seinen Reichtum berühmt war, wenn er auch nicht gerade aus glücklichen Geschäften seinen Reichtum aufgebaut hatte (obgleich man nie wissen kann !). Das ist der Fall während des babylonischen Exils und bald nachher. Wir erfahren aus den Berichten der Bibel, daß einzelne Exulanten nach kurzer Zeit in der Lage waren, Gold und Silber nach Jerusalem zu schicken (Zach. 6, 10, 11). Wir ersehen aus den Handelskontrakten der Nippurausgrabungen, daß die Juden während des Exils im Euphratlande eine hervorragende Rolle im Wirtschaftsleben spielten (564). Wir wissen, daß die aus dem Exil Heimkehrenden große Vermögen nach Palästina zurück brachten (Esra 1, 6—11). Berühmt wird später der Reichtum der Priesters (565). Auffallend ist die große Anzahl reicher und sehr reicher Männer unter den Talmudisten. Es läßt sich mühelos eine Liste von mehreren Dutzend Rabbinen aufstellen, denen ein großer Reichtum nachgerühmt wurde. Würde man die reichen Talmudgelehrten den armen gegenüberstellen, so ergabe sich — nach der Übersicht, die ich mir gemacht habe — ganz deutlich ein starkes Überwiegen der reichen (566).
Auch von den Juden in der hellenistischen Diaspora gewinnen wir den Eindruck der Wohlhabenheit und des Reichtums. Wo Juden und Griechen nebeneinanderwohnen, sind jene an Besitz überlegen, wie in Cassarea (567). Unter den Alexandrinischen Juden scheinen sich besonders viel reiche befunden zu haben: wir erfahren mehrfach von sehr reichen Alabarchen und sind den Alexandrinischen Juden schon an anderer Stelle als Geldgebern der Fürsten begegnet.
Ebenso besitzen wir aus dem frühen Mittelalter eine Reihe von Zeugnissen, aus denen sich mit ziemlicher Sicherheit entnehmen läßt, daß viele Juden auch damals mit Glücksgütern reich gesegnet waren. Wir sehen sie in Spanien dem Reccared Geld bieten, damit er die Bestimmungen der lex vis, gegen die Juden rückgängig macht (568). Wir erfahren aus vormuhamedanischer Zeit, daß die Araber sie wegen ihres Reichtums beneiden (569). Cordova zahlte im 9. Jahrhundert „mehrere tausend (!?) wohlhabende“ Familien unter den Juden (570). Und so fort (571).
Für das spätere Mittelalter ist der Reichtum der Juden so allgemein anerkannt, daß es keiner besonderen Begründung erst bedarfs (572). Und für die Zeit seit dem Ausgange des Mittelalters bis zur Gegenwart habe ich selbst eine Menge statistische Belege in diesem Buche beigebracht.
Man wird also getrost sagen dürfen: von Salomo bis Bleichröder und Barnato zieht sich der jüdische Reichtum wie ein goldener Faden durch die Geschichte, ohne an einer Stelle abzureißen. Ist das Zufall: Und wenn wir das nicht glauben mögen: hat es in objektiven oder subjektiven Momenten seinen Grund?
Um den Reichtum der Juden aus objektiven (äußeren) Umstanden zu erklären, hat man auf die Tatsache aufmerksam gemacht, daß die Juden frühzeitig darauf hingewiesen wurden im Gelde ihr höchstes Gut zu erblicken, und daß sie frühzeitig gezwungen wurden (wegen der Unsicherheit ihrer Lage), allen Reichtum nach Möglichkeit in leicht beweglicher Gestalt, also in Gold (Geschmeide) bei sich zu tragen, um ihn jederzeit verbergen oder mitnehmen zu können. So bedeutsam diese äußeren Umstande für die Entwicklung des jüdischen Reichtums gewesen sein mögen, so sind sie doch natürlich nicht hinreichend, diesen selbst zu erklären. Ich sehe ganz davon ab, daß jene äußere Lage, damit sie die genannte Wirkung ausüben konnte, Menschen ganz bestimmter Veranlagung treffen mußte (wie ich es für ähnliche Fälle schon ausgeführt habe); sehe davon ab, daß jene Tatsachen doch nur in der Diaspora wirken konnten: der wichtigste Einwand, der gegen die Stichhaltigkeit jener Beweisführung erhoben werden muß, ist doch natürlich der, daß jene eigentümliche Lage nur den Wunsch der Juden, reich zu sein, erklärt (und außerdem die Vorliebe für eine bestimmte Form des Reichtums). Daß aber der Wunsch in diesem Falle noch weniger als in anderen Fällen genügt, um auch seiner Erfüllung teilhaftig zu werden, ist — Gott seis geklagt — eine nur allzu bekannte Tatsache.
Wir müssen also, wenn wir den jüdischen Reichtum erklären wollen, nicht nach Gründen suchen, weshalb die Juden reich zu sein wünschen mußten (wer übrigens hatte diesen Wunsch auf Erden nicht, seit Alberich das Geld aus dem Rhein entwendete ?!), sondern nach den Gründen, die sie befähigten, reich zu werden (oder reich zu bleiben). Da hat man denn oft mit Recht wiederum auf eine Eigenart der äußeren Lage hingewiesen, in der sich die Juden Jahrtausende lang befunden haben: daß sie nämlich infolge ihrer Zurücksetzung im bürgerlichen Leben viel weniger Geld auszugeben Veranlassung gehabthätten als Christen in gleicher Vermögenslage, Ihnen sei der Begriff der standesgemäßen Lebenshaltung immer fremd geblieben und mit ihm „tausenderlei gemachte Bedürfnisse und Standesnotwendigkeiten.“ „Gewiß ist„, sagt ein Schriftsteller, der diesen Zusammenhängen mit feinem Gefühle nachgegangen ist (573),
„daß der Jude, gegen einen gleich vermögenden Christen gestellt, immer reicher werden muß, als dieser, da der Christ tausenderlei Mittel und Wege hat, von seinem Gelde zu verschwenden, die der Jude nicht zu betreten braucht, eben weil jener zur herrschenden und dieser zur tolerierten Klasse gehört. Bei den reich geborenen Juden aber treten wieder andere Verhältnisse ein: eben weil er keinen christlichen Standpunkt im gesellschaftlichen Leben inne hat, so ist der Luxus, dem er sich ergeben kann, kein standesgemäßer Luxus“.
Sicher ist hier eine Wurzel des jüdischen Reichtums aufgedeckt; wie denn dieses „unstandesgemäße Leben des Juden Veranlassung zu mancher andern wichtigen Wirtschaftsgestaltung geworden ist. An ihm hat die antinahrungsmäßige, freikonkurrenzliche Anschauung der Juden, der wir oben begegnet sind, sich gewiß ebenfalls entwickelt: jene modern bourgeoise Auffassung von der Wirtschaftsführung: daß man die Ausgaben nach den Einnahmen zu richten habe, eine Auffassung, die ja aller feudalen Gesellschaft fremd ist. An ihr ist wohl auch die Kategorie des Sparens ausgebildet worden, das wir frühzeitig als eine von den Juden gern geübte Praxis erwähnen hören.
Ein altes deutsches Sprichwort sagt schon:
- „Selten sind 7 Dinge:
- Eine Nonne, die nicht singe.
- Ein Mädchen ohne Liebe.
- Ein Jahrmarkt ohne Diebe.
- Ein Geißbock ohne Bart.
- Ein Jude, der nicht spart.
- Ein Kornhaus ohne Mäuse.
- und ein Kosak ohne Läuse.“
Aus ihm ist dann endlich wohl auch (als aus einer von vielen Wurzeln) die kapitalistische Akkumulation erwachsen: die Vermehrung des werbenden Vermögens aus den nicht verzehrten Teilen des Einkommens bei gleichzeitiger Erhaltung des kapitalistischen Betriebes. Was man in der Alltagsprache so ausdrückt: Das jüdische Geld bleibt länger im Geschäft und wächst rascher an als das christliche. Die Aufsaugung des Kapitals durch Seigneurialisierung und Feudalisierung der Lebensführung, also namentlich auch durch Erwerb von Landbesitz, war in früheren Zeiten bei den Juden nicht zu erwarten. Sparte also der Jude, so mußte er das Geld wieder dem Handel zuführen oder mußte es wenigstens doch als Rentenfonds im Darlehnsverkehr nützen, eine Anlage, die wir z. B. unter den Juden Hamburgs im 17. Jahrhundert ganz allgemein verbreitet finden: Glückel von Hameln und ihre Freunde und Freundinnen, wenn sie irgend eine kleine Summe erübrigt haben, leihen sie „auf Pfänder“ (wie man sie heutzutage auf die Sparkasse bringt) aus. Das Geld „warb“ also weiter, konnte sich weiter vermehren.
Aber so wichtig alle diese Beziehungen sind, sie festzustellen genügt nicht, um die Erscheinung des jüdischen Reichtums zu erklären.
Zunächst muß wieder daran erinnert werden, daß auch die zuletzt besprochenen „äußeren Umstände“ — die übrigens nur in der Diaspora und selbst hier nicht ganz allgemein vorhanden waren — wirkungslos bleiben würden, wenn ihnen nicht eine bestimmte Eigenart der Menschen, die ihrer teilhaftig werden, entsprüche. Daß ein Volk „sparsam“ wird, kann doch niemals ein äußerliches Schicksal allein bewirken. Das leuchtet ohne weiteres von selbst ein und wird zudem noch von ganz bestimmten Erfahrungstatsachen bestätigt. Wir finden, daß heutigentags, nachdem der Ghettorwang längst beseitigt ist, nachdem auch den Juden der Weg zur Feudalisierung ihrer Lebensführung frei gegeben ist, daß auch heute noch die Juden als ein Ganzes, sparsamer sind als die Christen, Folgende Ziffern erweisen das:
Im Großherzogtum Baden stieg (nach dem Statist. Jahrb. für d. Grhzt. Baden) das Kapitalvermögen in dem Zeitraum von 1895 bis 1903:
- bei Evangelischen von 100 auf 128,3
- bei Juden von 100 auf 138,2
obwohl im gleichen Zeitraum das Einkommen
- bei Evangelischen von 100 auf 146,6
- bei Juden von 100 auf 144,5.
gestiegen war.
Aber wie auch immer hier die subjektivistischen zu den objektivistischen Ursachen sich verhalten mögen: es bleibt doch vor allem zu bedenken, daß alle bisher angeführten Umstände immer nur geeignet sein konnten, vorhandenes Vermögen zu erhalten oder erworbenes rascher (durch Akkumulation) zu vermehren. Zu Reichtum würden die Umstände nicht führen können weil dieser doch erst einmal erworben werden muß, ehe er erhalten und vermehrt werden kann. Und dazu gehört natürlich letzten Endes Talent, und wenn dieses in einer Bevölkerungsgruppe so verbreitet ist wie bei den Juden, läßt es auf ein besonderes Wesen schließen.
IV. Die rassenmasige Begründung volklicher Eigenarten
Das Ergebnis unserer bisherigen Untersuchungen ist dieses: sehr wahrscheinlich ist der anthropologische Charakter der Juden ebenso wie ihr geistiges Wesen seit mehreren tausend Jahren konstant geblieben, weisen beide während einer sehr langen Periode, vielleicht sogar während der ganzen „historischen“ Zeit, ein bestimmtes, ein eisernes Gepräge auf.
Was ist mit dieser Feststellung nun bewiesen: Etwa daß die geistige Eigenart der Juden rassenmäßig begründet sei? Die dogmatischen Vertreter des Rassenglaubens antworten natürlich ja; wir, die wir kritisch verfahren wollten, müssen antworten: nein — bewiesen ist noch gar nichts.
Es verlohnt sich wohl, den Beweisführungen unserer „Rassentheoretiker“ nachzugehen, um zu sehen, wie alle ihre Behauptungen vollkommen in der Luft schweben; wie sie Sätze zweifelhaftester Gültigkeit mit einer Sicherheit aufstellen, die eben nur der durch keine Erkenntnisskrupel getrübte Glaube aufzubringen imstande ist. Die meisten Vertreter der „Rassentheorie“ (ich brauche nicht immer zu betonen, daß ich damit nur diejenigen meine, die durch ihre voreiligen Schlußfolgerungen diese an sich höchst wertvolle Methode kompromittiert haben, nicht etwa alle diejenigen, die von der überragenden Bedeutung des „Rassenfaktors“ in der Geschichte überzeugt sind — zu diesen gehöre ich selber und ich glaube, daß gerade im Interesse einer wissenschaftlichen „Rassentheorie“ die unzulängliche Art aufgedeckt werden muß, mit der bisher in zahlreichen Fällen das Problem behandelt ist), alsdann (in diesem Sinne): die meisten Vertreter der Rassentheorie geben sich nicht einmal die Mühe, einen a posteriori-Beweis für die Richtigkeit der von ihnen aufgestellten Behauptungen zu erbringen. Sie kommen vielmehr zu ihrer Einsicht auf ganz direktem Wege vermittels des sehr einfachen Schlusses: Rassen haben eine spezifische geistige Eigenart diese Bevölkerungsgruppe, also in unseren Falle: die Juden sind eine Rasse — folglich haben die Juden eine rassenmäßig begründete Eigenart; oder: folglich ist die an den Juden heute festgestellte Eigenart in ihrer Rassenbesonderheit begründet.
Es gilt nun mit aller Entschiedenheit auszusprechen, daß für die Richtigkeit dieses Satzes sich kein zwingender Beweis erbringen läßt. Seine beiden Teile: Ober- und Untersatz, entbehren der Begründung. Über den Inhalt des Untersatzes: „die Juden sind eine Rasse“ habe ich mich schon geäußert. Er kommt hier aber gar nicht so sehr in Betracht angesichts der viel ernsteren Tatsache, daß wir, um die Richtigkeit des Obersatzes: „bestimmte Rassen haben eine bestimmte geistige Eigenart“ zu beweisen, einstweilen kein genügendes Beweismaterial besitzen, Wir müssen frank und frei bekennen: über den Zusammenhang zwischen bestimmten somatischen (anthropologischen) Merkmalen und dem psychischen Gehaben des Menschen — als Einzelwesen und somit auch als Gruppentyp — wissen wir schlechthin nichts.
Man weiß, wie Linné die Menschenrassen einteilte:
Die vier Menschenrassen nach Linné
I. Mensch (Homo sapiens). Erkenne Dich selbst,
1. Homo diurnus, der Tagmensch, varierend durch Kultur und Wohnort. Vier Varietaten:
- Der Amerikaner (Americanus): Rötlich, cholerisch, gerade aufgerichtet. Mit schwarzen, geraden, dicken Haaren, weiten Nasenlöchern; das Gesicht voll Sommersprossen, das Kinn fast bartlos. Hartnäckig, zufrieden, frei; bemalt mit labyrintischen (dadalischen) Linien; regiert durch Gewohnheiten.
- Der Europäer (Europaeus): Weiß, sanguinisch, fleißig. Mit gelblichen, lockigen Haaren, bläulichen Augen. Leichtbeweglich, scharfsinnig, erfinderisch; bedeckt mit anliegenden Kleidern; regiert durch Gesetze.
- Der Asiate (Asiaticus): Gelblich, melancholisch, zäh. Mit schwärzlichen Haaren, braunen Augen, Grausam, prachtliebend, geizig, Gehüllt in weite Gewänder; regiert durch Meinungen.
- Der Afrikaner (Afer): Schwarz, phlegmatisch, schlaff. Mit kohlschwarzen, (contortuplicatis) Haaren, mit ganz glatter,seidenartiger Haut (wie Samt), platter Nase, aufgeschwollenen Lippen; die Weiber mit Hottentottenschürzen und während des Saugens mit verlängerten Brüsten (feminis sinus pudoris, mammae lactantes prolixae). Schlau, träge,gleichgültig; mit Fett gesalbt; regiert durch Willkür.
Heute lächeln wir über diese Naivität. Aber haben wir das Recht dazu? Verfahren unsere „Rassensystematiker“ nicht viel naiver, viel willkürlicher? Auch wenn sie mit noch soviel Schädelmaßen um sich werfen: Ist denn der Unfug nicht geradezu unerhört, der mit der Lang-Schädel Kurz-Schädeltheorie getrieben worden ist und immer gelegentlich noch getrieben wird? Sollte man es überhaupt für möglich halten, daß allen Ernstes ein Zusammenhang zwischen Schädelform und Art und Maß der Kulturfähigkeit aufgestellt werden konnte, ohne die Probleme der Gehirnanatomie und Gehirnfunktionen auch nur mit einem Gedanken in Rücksicht zu ziehen? Mit solchen Hypothesen: der Langschadel ist ein Herrenmensch, der Kurzschädel ist ein Sklavenmensch, ging man ja, ohne es zu ahnen, weit hinter den alten Gall zurück.
Nach den neuesten Untersuchungen Nyströms u. a. wird nun wohl der Lärm der Dolichozephalomanen etwas verstummen. Aber es hatte eigentlich derartiger Feststellungen nicht bedürfen sollen, um die Windigkeit der Schädelkulturtheorien aufzudecken. Man hätte den Herren einfach zurufen sollen: bitte, erbringt ihr erst den Beweis, daß zwischen Schädelform (und natürlich ebenso zwischen Fussohlen- und Nasenform: es gibt bekanntlich auch Nasen-Kulturtheoretiker) und menschlich geistigem Wesen ein irgendwelcher Zusammenhang besteht.
Oder soll man den Versuch eines solchen Beweises in den bekannten Worten Chamberlains erblicken: Den germanischen Langschädel habe „ein ewig schlagendes, von Sehnsucht gequaltes Gehirn aus der Kreislinie des tierischen Wohlbehagens hinaus gehämmert„? Zweifellos steckt in diesen Worten eine ganze Menge recht poetischen Empfindens, und niemand, der sich ein empfängliches Gemüt bewahrt hat, wird der eindrucksvollen Wucht dieses Gedankens sich entziehen können. Aber ein „Beweis„? Mit genau demselben Recht – wenn die neueren Untersuchungen richtig sind, wonach der Kurzschädel durch starke geistige Arbeit sich aus dem Langschädel herausbilden soll, sogar mit größerem Recht; es gibt jetzt in der Tat schon einen Brachyzephalen-Stolz! — könnte ein Brachyzephalomane etwa sagen: „den von ungebändigten Naturtrieben nach vorn hinaus gedrängten Langschädel führt die gefestigte Geistigheit, die zur Harmonie durchgedrungene Seelenhaftigkeit des Edelmenschen an die jene in sich ruhende Wesenheit gleichsam symbolisch ausdrückende Kreislinie des Rundkopfes immer näher heran.
Oder ist das ein „Beweis„: Hier sehe ich eine Kultur, die mir wertvoll erscheint, als das Werk einer besonderen Rasse – sage der Germanen; dort sehe ich eine andere Kultur, die mir auch wertvoll erscheint; Schluß: so kann sie nur das Werk von Germanen sein? Zwar erscheinen ganz anders geartete Völker, als ihre Träger, Dann sind eben Germanen dort gewesen, die jenen den Kulturkeim eingeimpft haben.
Sicher regt eine solche Schlußfolgerung Herz und Gemüt zu Freude und Befriedigung an. Sicher läßt sich in solcher Hypothese ein neuer „Glauben“, wennschon der alte Juden oder Christenglauben nicht mehr verfängt, leidlich sicher verankern — wie denn alle diese „Theorien“ von dem Kulturberuf einer „Edelrasse„: die Ariertheorie, die Germanentheorie nichts anderes sind als eine dem „modernen“ Empfinden angepaßte Erneuerung des alten Glaubens an das auserwählte Volk Gottes. Sie sollen auch als solche unangefochten bleiben.
Nur sollen sie nicht ein wissenschaftliches Mäntelchen umhängen. Wissenschaft und Glaube sollen auch hier — im Interesse beider — hübsch getrennt bleiben. Wie wir die Schöpfungsgeschichte der Genesis oder die Himmelfahrt Christi mit inbrünstigem Herzen glauben mögen, ohne doch den Anspruch zu erheben, daß in jenen Erzählungen wissenschaftliche Erkenntnisse der Erdentstehung oder der Sternenwelt enthalten seien ebenso sollen die Langschädelgläubigen oder die Germannngläubigen ruhig bei ihrem Glauben verharren, sie sollen nur nicht die Kreise der Wissenschaft stören dadurch, daß sie behaupten, ihre Annahmen seien aus wissenschaftlicher Erkenntnis hervorgegangen oder hätten überhaupt etwas mit Wissenschaft zu tun.
Aber auch wenn die Vertreter der traditionellen Rassentheorie sich zu einer Art von empirischem Beweise verstehen, ist ihre Beweisführung ganz und gar nicht schlüssig. Sie pflegen nämlich als Argument für die rassenmäßige Verankerung der geistigen Eigenart eines Volkes deren Konstanz anzuführen und glauben, ihren Beweis lückenlos geführt zu baben, wenn sie die volkliche Eigenart etwa bis in die Anfänge der Geschichte oder gar bis in die Sage oder Mythologie hinauf verfolgen können.
Die Schilderungen der Gallier bei Casar, der Germanen bei Tacitus haben schon oft genug herhalten müssen, um gewisse Züge des französischen oder deutschen Volkes in der Gegenwart, die mit den Charakterzeichnungen jener römischen Schriftsteller übereinzustimmen scheinen, in einer rassenmäßigen Veranlagung zu begründen. Dasselbe Verfahren hat man natürlich auch bei den Juden angewandt.
Demgegenüber ist nun zu betonen, wie ich es vorhin schon getan habe, daß auch der Nachweis einer sehr langen Konstanz, gewisser geistiger und körperlicher Merkmale durchaus noch nicht die Annahme einer blutsmäßigen Verankerung der geistigen Eigenart rechtfertigt. Denn da wir, wie gesagt, über die gegenseitige Bedingtheit somatischer und psychischer Wesenheit nichts Bestimmtes auszusagen vermögen, so müssen wir die Möglichkeit zugeben, daß die Konstanz bestimmter körperlicher und bestimmter geistiger Merkmale eines Volkes ohne inneren Zusammenhang besteht, auf selbständig wirkende, voneinander unabhängige Ursachenreihen sich zurückführen läßt.
In der Tat liegt kein Grund vor, weshalb eine durch die Jahrtausende konstant bleibende geistige Eigenart nicht in jeder Generation durch bestimmte äußere Einflüsse neu entstehen, oder aber von einer Generation auf die andere durch Tradition übertragen werden könnte.
Gerade in einem Volke, in dem die Überlieferung so mächtig ist, wie im jüdischen, wo die Abschließung, der starke Familiensinn, der religiöse Kultus, das ununterbrochene, eifrige Studium des Talmud und andere Umstände eine ganz ungewöhnlich hohe Technik zur Erhaltung und Übertragung eines vorhandenen Traditionsstoffes ausgebildet haben, ist es immerhin nicht außerhalb des Bereichs aller Möglichkeit gelegen, daß gewisse Eigenarten durch Erziehung immer wieder angeeignet werden, ohne in das Blut einzudringen, ohne auch nur zu einer bestimmten körperlichen „Anlage“ sich zu verhärten.
Aber — und damit wende ich mich nun mit ebensolcher Entschiedenheit gegen die Anpassungs- und Milieufanatiker: wenn ich eben die Beweisführung der „Rassentheoretiker“ als unzulänglich bezeichnet habe, so ist damit noch ganz und gar nicht gesagt, daß sie mit ihrer Behauptung einer blutsmäßigen Begründung der jüdischen Eigenart unrecht haben. Denn die Gründe, die von den Gegnern zur Widerlegung dieser Ansicht angeführt werden, sind nicht stichhaltige. Man beruft sich in diesen Kreisen mit Vorliebe auf die Tatsache, daß die Juden im Altertum so ganz anders sich betätigt hatten als heute; daß sie damals tapfere Krieger und Ackerbauer gewesen seien, heute dagegen nach dem Urteil Herders „ein verächtliches Geschlecht schlauer Unterhändler“ (wie unlängst wieder das Zionistenblatt Hatikwah in einer Polemik mit mir schrieb). Das beweist nun aber (selbst wenn es richtig wäre: ich habe schon gezeigt, daß die Tatsachen falsch sind) natürlich gar nichts gegen die blutsmäßige Begründung der jüdischen Eigenart.
Denn:
- können sehr wohl in einer Zeit, in der das Volk sich als kriegerisches darstellte, Typen mit anderer — sagen wir kommerzieller — Veranlagung vereinzelt vorhanden gewesen sein, die im Lauf der Zeit durch Ausmerzung der anders veranlagten Elemente zur Mehrheit gelangt sind und infolge nun ebenso die volkliche Eigenart bestimmen, wie damals ihre Antipoden (die vielleicht jetzt auch noch da sind, aber dank ihrer geringen Zahl nicht ins Gewichtfallen).
- müßte erst sehr genau untersucht werden, ob scheinbar entgegengesetzte Betätigungsarten nicht doch auf eine unddieselbe Blutseigenschaft zurückzuführen sind, sodaß also die Gesamtanlage, somit seine eigentliche volkliche Eigenart, sehr wohl dieselbe bleiben kann, während die Lebensäußerungen des Volkes ganz verschiedene (als Krieger oder Börsenleute) sind.
- wäre denkbar, daß bestimmte Anlagen zwar vorhanden sind und im Blute stecken, lange Zeit hindurch aber nichtGelegenheit haben, sich zu betätigen, daß dann später erst durch äußere Umstände die Gelegenheit zur Entfaltungdieser Keime geboten wird.
Ebensowenig schlüssig ist der Beweis der Milieutheoretiker, wenn diese die heutige Eigenart der Juden aus bestimmten, historischen Zufälligkeiten abzuleiten versuchen. Solch ein Komplex von Ursachen, der die jüdische Eigenart bewirkt haben soll, ist beispielsweise die Religion; ein anderer, der mit Vorliebe angeführt wird, ist das Ghettoleben. Ein dritter: ihre Jahrhunderte lange Beschäftigung mit Geldsachen. Nun kann ohne weiteres zugegeben werden, daß diese Lebensschicksale den Juden ihr Gepräge aufgedrückt haben. Nur beweist das ganz und gar nichts gegen die Richtigkeit der Annahme, daß die besondere Eigenart, die man aus der Religion oder aus dem Ghettoelend oder aus der Leihtätigkeit erklärt, nicht doch im Blute steckt.
- enthält der Nachweis, daß eine Ursache gewirkt habe, noch keine Widerlegung der Annahme, daß dieselbe Erscheinung, die man begründen will, nicht mehrere Ursachen gehabt habe.
- läßt der Nachweis, daß gewisse Eigenarten durch bestimmte, historische Ereignisse hervorgerufen seien, immer noch den Zweifel bestehen: ob denn diese geschichtlichen Umstände nicht etwa selbst erst durch die Eigenart derer bewirkt worden seien, die sie erlebt haben. Für die jüdischeReligion und den Leihverkehr habe ich schon einige Gründe angeführt, die die Umkehrung des Kausalverhältnisses sehr plausibel machen. Daß aber auch das Ghettoleben letzten Endes nicht die Ursache, sondern die Wirkung der jüdischen Eigenart sei, dürfte sich mit ähnlichen Erwägungen ebenfalls leicht nachweisen lassen. Ich komme darauf im nächsten Kapitel noch zu sprechen.
Die bisherigen Untersuchungen haben das Ergebnis gehabt, daß keine der beiden Ansichten von der Beschaffenheit der jüdischen Eigenart den Beweis für ihre Richtigkeit zu erbringen vermocht hat. Daraus folgt nun aber wiederum keineswegs, daß nicht die eine oder die andere Ansicht richtig sei (was ja selbstverständlich ist), sondern nicht einmal, daß die Richtigkeit der einen oder der anderen Ansicht nicht doch erwiesen werden könne. Wir brauchen jedenfalls die Hoffnung nicht aufzugeben, doch schließlich noch einmal „aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen“ Ich glaube nur, daß wir die Wegrichtung ein wenig ändern müssen, um zum Ziel zu gelangen und will im folgenden – ehe ich eine selbständige Deutung der jüdischen Eigenart versuche — angeben, wie wir uns — meiner sehr bescheidenen Meinung nach — bei dem heutigen Stande der anthropologisch-biologischen Wissenschaften zu dem Problem der Artbildung (in dem hier verstandenen Sinne) zu verhalten haben, indem ich dabei gleichzeitig den Versuch mache, die Ergebnisse jener naturwissenschaftlichen Disziplinen mit einigen neueren soziologischen Einsichten in Verbindung zu setzen.
Diejenige Forschungsmethode, die uns bisher die meiste Aufklärung über alle jene Phänomene gebracht hat, die man unter dem nicht ganz eindeutigen Sammelbegriff der Rassenbildung zusammenfassen kann, ist die genetische, die sich vielleicht als geographisch-genetische und ökonomisch-genetische wiederum unterscheiden ließe. Man weiß, daß jene vor allem den Arbeiten von Moritz Wagner, Kollmann, Bastian (574) ihre Entstehung verdankt, während sich um die ökonomisch-genetischen Untersuchungen bisher nur wenige Forscher gekümmert haben. Außer den Werken von Gumplovice (575) kommen hier hauptsächlich die Arbeiten der Ecole des Roches in Betracht, die sich um die „Science sociale“ gruppiert (576) (deren Hauptmangel aber darin besteht, daß sie nur die Entstehung der sozialen Organisation, fast gar nicht die der Menschentypen selbst verfolgt).
Was danach übereinstimmend angenommen wird, ist dieses: Die Spezies Mensch, man mag sich ihren Ursprung monogenetisch oder polygenetisch (ganz neuerdings wieder mit Vorliebe!) vorstellen, entwickelt sich während der ersten Periode ihres Daseins an verschiedenen Stellen der Erde — in den sogenannten Isolationszentren M. Wagners — in verhältnismäßig kleinen Trupps zu verschiedenartigen Typen. Sie „differenziert“ sich und zwar — wie ebenfalls von keiner Seite bestritten wird — unter dem Einfluß der Umgebung, in die sie der Zufall der Wanderung gerade verschlagen hat. Was hier als „Umgebung“ anzusehen ist, und welche Bestandteile der „Umgebung“ von besonderem Einfluß auf die Herausbildung der Unterschiedlichkeiten gewesen sind, hat man bisher nur aphoristisch anzugeben vermocht. Hier werden vor allem in der Zukunft die Untersuchungen einzusetzen haben, die entweder ethnographisch beschreibender Natur oder experimenteller Natur sein können. Jene, wie etwa die Arbeiten C. Hart Merrians (577), werden vielmehr noch als bisher die allgemeinen Lebensbedingungen der Naturvölker in ihrem Zusammenhange mit deren anthropologischer Eigenart in Rücksicht ziehen müssen; diese werden zu prüfen haben, welche Wirkungen die einzelnen Faktoren der Umgebung auf willkürlich ihnen ausgesetzte Lebewesen auszuüben vermögen. Das Ergebnis dieser Untersuchungen wird eine Lehre von den Reizen sein, zu der wir bisher nur wenige Ansätze besitzen, denn mir scheint Rob. Sommer den Nagel auf den Kopf zu treffen, wenn er „Milieu“ „nichts anderes als eine große Summe von Reizen„ (578) nennt.
Diese Reize ausübenden Faktoren sind nur zum Teil klimatischer Natur im engeren Sinne; überwiegend wird man sich darunter die sekundären Naturbedingungen, wie Fauna und Flora vorzustellen haben, vor allem aber die aus allen diesen Elementen bestimmten Lebensbedingungen des Menschen selber: die Eigenart der Technik und die Form des Unterhalts werden hierunter wieder die vornehmsten sein. Ob die Menschen zum Fischfang, oder zur Jagd, oder zum Ackerbau, oder zur Viehaucht, oder zu welcher besonderen Wirtschaftsweise durch die besondere Gestalt ihrer Umwelt gedrängt wurden, mußte natürlich bei der Ausbildung ihres Typs von entscheidender Bedeutung werden. Und mir scheint — im Vorbeigehen bemerkt — an dieser Stelle der Punkt zu liegen, wo die ökonomische Geschichtsbetrachtung und die rassenmäßige Geschichtsauffassung oder, um sie jener logischer gegenüberzustellen: die anthropologische Geschichtsbetrachtung sich schneiden. Die Besonderheit des Wirtschaftslebens hat in den Anfängen des Menschengeschlechts den anthropologischen Charakter der einzelnen Gruppe wesentlich mitbestimmen helfen, der dann im späteren Verlaufe der Menschheitsgeschichte selbst wieder entscheidend wurde für die Gestaltung des Wirtschaftslebens. Hier ist aber auch der Punkt in der Menschheitsentwicklung, wo allein der funktionelle Zusammenhang zwischen geistiger und somatischer Besonderheit der einzelnen Gruppe entstanden sein kann: zu einer Zeit, als die Eigenart der gesamten Lebensbedingungen formend und gestaltend auf die Gesamtheit der menschlichen Organe einzuwirken imstande war. Wir können uns den Bildungsprozeß schlechterdings nicht anders vorstellen, als daß er gleichzeitig das körperliche und geistige Behaben in ganz genau derselben Richtung langsam in eigentümliche Bahnen lenkte.
Langsam: denn wir müssen die Zeit der Differenzierung des Menschengeschlechtes in unterschiedliche Typen außerordentlich lang bemessen. Wenn sich der tertiäre Mensch wirklich nachweisen lassen sollte, wie es jetzt fast den Anschein hat, so werden die Anfange des Menschengeschlechts in neue unermeßliche Fernen zurückverlegt. Aber wenn wir auch nur das Quartär als die Periode des Menschen ansetzen, so haben wir mit Zeiträumen von 250—500 000 Jahren zu rechnen, in denen sich die verschiedenen Menschenrassen entwickelt haben. Auf welchem Wege die Herausbildung der menschlichen Unterarten erfolgt ist, läßt sich natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Nur daß man von den drei Möglichkeiten eben für jene Periode die Vermischung ausschließt. Dagegen bleibt die Frage offen, ob die Artveränderung auf dem Wege der Auslese oder durch somatogene Mutation bewirkt worden ist.
Genug — am Ende dieser Epoche, die man wohl vor die diluviale Eiszeit zu setzen hat, leben auf der Erde eine Anzahl blutsunterschiedlich gestalteter Gruppen von Menschen, die man als Urrassen oder vielleicht als Rassen schlechthin bezeichnen kann. Welcher Art diese waren, worin vor allem sie sich untereinander unterschieden, läßt sich selbstverständlich nur vermuten. Wir können nur die Grenzen etwas umschreiben, innerhalb deren sich die Unterschiedlichkeiten bewegen konnten und müssen vor allem feststellen, daß diese zu keiner Zeit so groß gewesen sein können, um die verschiedenen Rassen als besondere Arten zu bezeichnen, da die Mischung zwischen ihnen stets eine lebensfähige Nachkommenschaft ergab. Sie waren also immer nur „Unterarten“ oder gar nur „Spielarten“ der Spezies Urmensch und weisen somit stets eine große Menge gleicher Züge in somatischer wie psychischer Hinsicht auf. Es ist bekannt, daß diese übereinstimmende Allgemeinmenschlichkeit Anlaß geboten hat zu einer Fülle von Entwicklungsschematen für den Werdegang der Einen Menschheit: von Herder über Hegel und Morgan bis Spencer und Breysig. Natürlich interessiert uns dieser Zweig der Forschung an dieser Stelle nicht, wo es uns nur darauf ankommt, im Gleichen das Verschiedene festzustellen.
Leider gibt es nun keine Möglichkeit, die Obergrenze dieser Verschiedenheit mit ebensolcher Sicherheit anzugeben, wie die Untergrenze. Nur daß sie über der heutigen Unterschiedlichkeit der verschiedenen Völker gelegen war, die ja schon Vermischungsprodukte sind, darf als sicher angenommen werden.
Das Seltsame an dieser Betrachtungsweise, die ich die genetische nenne (579), aber grade auch das, was Vertrauen zu ihr erweckt, ist dieses: daß sie einstweilen nur Möglichkeiten, höchstens Wahrscheinlichkeiten kennt, die sich nur in unserm ordnenden Verstande einstweilen zu Notwendigkeiten verdichten, die aber den wunderbaren Vorzug voraus haben, daß sie mit keinem sicheren Ergebnis der bisherigen Erfahrung in Widerspruch stehen und infolgedessen die sicherste Anwartschaft auf dereinstige Bestätigung durch empirische Forschung haben. Einstweilen wird nicht mehr behauptet als dieses: daß die im Augenblick denkbarste Weise der Menschenentwicklung infolge der verschiedenen Lebensschicksale der einzelnen Gruppen im Laufe von Myriaden von Jahren aller Wahrscheinlichkeit nach deren verschiedenes Gepräge bewirkt habe, das sich uns in den offenbar auch heute noch von einander verschiedenen Menschengruppen darstellt.
Wir verzichten aber einstweilen darauf, diese Verschiedenheiten in der Aufzählung einer Anzahl bestimmter Merkmale auszusprechen bezw. festzulegen, noch viel mehr aber darauf, die notwendigen Zusammenhänge zwischen solchen Merkmalen und den hypothetischen, sonderartigen Lebensschicksalen der einzelnen Gruppen aufzudecken: die Lösung dieser Aufgabe ist späteren Untersuchungen vorbehalten.
Dabei wird voraussichtlich der Weg der sein: daß man von dem — unserer Erfahrung naher liegenden — Tatbestande bestimmter psychischer Eigenarten ausgeht und deren Zusammenhang mit bestimmten äußeren Existenzbedingungen aufweist, dann die Kreuzung bestimmter somatischer Merkmale mit den beobachteten psychischen Sonderheiten feststellt und nunmehr erst jene eigenartigen, anthropologischen Erscheinungen, die eine bestimmte Gruppe aufweist, als Ausdruck oder Wirkung jener eigentümlichen Lebensbedingungen der Gruppe zu deuten unternimmt. (Einen Versuch, in diesem Sinne zu forschen, enthält das letzte Kapitel dieses Werkes.)
Freilich wird nun bei diesem Beginnen sich eine neue Schwierigkeit auftürmen: Jene Urrassen, jene einseitig entwickelten Gruppen der Differenzierungsperiode gibt es vielleicht heute gar nicht mehr. Jedenfalls können wir mit Bestimmtheit aussagen, daß alles, was wir Kulturvölker nennen, ganz sicher aus einer Vermischung verschiedener Urrassen hervorgegangen ist. Wir haben jetzt gerade die deutliche Vorstellung, daß alle Staatenbildung, durch die allein ein Aufschwung zu höheren Formen der Kultur gedacht werden kann, auf die Zusammenschweißung jener (auf ihren Wanderungen endlich einmal aufeinanderprallenden) Sondergruppen (die Durkheim das soziale Protoplasma nennt) beruht; daß also alle Staatenbildung immer gleichzeitig eine anthropologische Neugestaltung durch Mischung verschiedener Rassen bedeutet. Auf die Periode der Differenzierung würde demnach eine Periode der Integrierung oder, wie es Kollmann bezeichnet, der Penetration folgen, in der wir heute noch leben.
Nun müssen wir uns aber gestehen, daß von diesem Augenblick an unser Wissen von den wirklichen Vorgängen (vielleicht weil es vom Tatsachenmaterial mehr belastet ist) noch unsicherer erscheint, daß also noch größere Vorsicht geboten ist, wenn wir uns unterfangen, irgendeine bestimmte Aussage zu machen.
Zunächst erhebt sich die Frage: welches Ergebnis zeitigt eine Mischung verschiedener menschlicher Spiel- oder Unterarten untereinander; was wird dabei aus den ursprünglich verschiedenen somatischen und psychischen Besonderheiten der einzelnen Spielart? Ehrliche Antwort: wir wissen es nicht. Zwar ist viel philosophiert worden über die „Vorzüge“ und „Nachteile“ solcher Mischungen: eine Kreuzung verschiedener Rassen, meint Chamberlain, ergibt „gute Resultate, wenn die Rassen verwandt sind, „schlechte“ wenn nicht. Und antwortet auf die Frage: welche Rassen „verwandt“ sind: Nun, eben die, deren Kreuzung „gute“ Resultate liefert.
Aber damit ist noch nicht allzuviel Erkenntnis gewonnen. Auch was wir an persönlicher Erfahrung besitzen, reicht natürlich nicht aus, um ein abschließendes Urteil zu fällen. Wir wissen von vielen Mischungen, daß sie besonders schöne Menschen — vor allem wunderschöne Frauen —, aber Menschen hervorbringen, die nicht recht lebensfähig und häufig seelisch oder moralisch disquilibriert sind (530). Doch, was will das besagen? Bedeutsamer sind schon die Untersuchungen von Woltmann, Leo Sofers (531) und anderen über die „Entmischungen“. Danach soll es feststehen (!),
„daß in den gemischten Rassen immer wieder Entmischungen stattfinden, daß die Typen bis zu einem gewissen Grade der organischen Verschmelzung widerstehen, und daß fremdrassige Elemente, wenn sie nicht allzu zahlreich sind, nach mehreren Generationen wieder vollständig aus dem plasmatischen Keimprozeß der Rasse ausgeschaltet werden können.“
(Sofer glaubt solche „Entmischungen gerade bei den Juden nachweisen zu können.)
Übrigens wird das Problem der Mischungen nur dann für die Erklärung volklicher Eigenart bedeutsam, wenn die sich mischenden Rassen sehr heterogener Art wären, das heißt also – nach unserer Auffassung, -aus grundsätzlich verschiedenen Lebenskreisen hervorgegangen sein würden: wenn etwa ein nomadisierendes Wüstenvolk sich mit einem ackerbautreibenden Nordlandvolke mischt oder mit einem Volke, das in Tropenwäldern die Jahrtausende verbracht hätte. Wo sich „verwandte“ (in dem hier genau beschriebenen Sinne) Rassen kreuzen, kann offenbar die Veränderung des Typs niemals eine sehr große sein.
Immerhin kommt, seitdem die Rassenmischungen, d. h. die Völkerbildungen einsetzen, die Kreuzung als neues Art bildendes Moment zu den beiden übrigen: Auslese und somatogene Mutation hinzu.
Man mag sich nun die Wirkungen der Völkermischung wie immer vorstellen: etwa im Bilde einer Flüssigkeit, in der ein fester Körper vollständig „gelöst“ ist; oder eines Sees, in dem auf weite Strecken hinaus die Wasser zweier Ströme, die in ihn münden, nebeneinander herfließen; oder eines chemischen Körpers, in dem die Atome in einem bestimmten Verhältnis zueinander gelagert sind: immer wird man annehmen müssen, daß nach erfolgter Mischung nun abermals eine Gruppe von Menschen mit ganz bestimmter Blutseigenart entstanden ist. Denn es wäre eine ganz widersinnige Vorstellung, daß durch die Mischung verschiedenen Blutes das Blut selber aus der Welt geschafft werden könnte.
Wenn wir damit feststellen, daß auch in jeder Volksgemeinschaft ebenso wie zuvor in den „reinen Urrassen bestimmte Blutseigenschaften notwendig gedacht werden müssen, so bedeutet das: daß bestimmte Besonderheiten des Körpers und des Geistes in den Angehörigen dieser Volksgemeinschaft sich dauernd erhalten, das heißt durch Vererbung übertragen werden (532). Zu betonen wäre nur mit Entschiedenheit, daß es sich dabei niemals um „Fertigkeiten“ handeln kann, sondern immer nur um Fähigkeiten, diese Fertigkeiten (eicht oder leichter oder überhaupt durch Übung zu erwerben, um „Dispositionen“, um „Anlagen“ deren Wesenheit man jetzt erst allmählich zu erforschen trachtete (533). Nicht das Masurkatanzen und nicht das Flötenspiel stecken einem Menschen „im Blute“, wohl aber die tanzliche oder musikalische „Begabung„, die ihrerseits wieder (vielleicht in Gemeinschaft mit andern ähnlichen Begabungen) in bestimmten Grunddispositionen des Nervensystems verankert sein wird.
Wenn nun auch eine solche blutsmäßige Veranlagung und dem entsprechende Ausstattung der Individuen und Völker mit besonderen vererblichen Eigenarten kaum noch von jemand ernstlich bestritten wird, so könnte es wenigstens den Anschein erwecken, als herrsche Meinungsverschiedenheit selbst zwischen berufenen Vertretern der Wissenschaft über das Maß von Konstanz (oder Veränderlichkeit), das jene blutsmäßige Veranlagung (wie ich aus ästhetischen Gründen statt keimplasmatische es nennen möchte) besitzt. Es könnte den Anschein haben, sage ich, als wären die einen der Meinung: die Veranlagung der Menschengruppen (Völker) sei mindestens seit ihrer heutigen Zusammensetzung – also in der sogenannten „historischen“ Zeit oder seit dem Ende der diluvialen Glazialepoche — unverändert, während die anderen eine solche Veränderung (und damit von einem gegebenen Zeitpunkt vorwärts schauend Veränderlichkeit) des Keimplasmas oder der Erbsubstanz, wie Schallmayer es ausdrückt, anzunehmen bereit seien. In Wirklichkeit aber, glaube ich, besteht jene Meinungsverschiedenheit unter den Fachleuten (und das sind in diesem Falle die Biologen) heute nicht mehr oder wenigstens nur noch in ganz geringem, für die anthropologisch-ethnologischen Probleme kaum noch praktischem, Umfange, Ein naiver „Lamarckismus“ wird heute wohl nur noch angetroffen unter Ärzten und Soziologen, die den biologischen Studien fern stehen und meistens nicht einmal die Fragestellung in voller Klarheit in ihrem Innern lebendig zu machen vermocht haben.
Die Anschauung, als ob so ungefähr jede äußere Lebensbedingung imstande wäre, den Organismus aus seinen vorgeschriebenen Bahnen abzulenken, darf heute als überwunden angesehen werden. Selbst diejenigen Forscher, die in gewissem Umfange die „Vererbung erworbener Eigenschaften“ für möglich halten, zweifeln doch nicht mehr daran, daß diese „Eigenschaften“ die vererbt werden sollen, ganz besonderer und seltener Natur sind, derart nämlich, daß sie die Keimsubstanz selber erfassen. Ob aber das andere als zerstörende Einflüsse sind (wie sie durch Gifte bewirkt werden), ist außerordentlich zweifelhaft. Auch die Mneme-Theorie R. Semons scheint mir an dieser Auffassung nichts Wesentliches zu ändern. Sie besagt doch auch nur, daß unter besonderen Umständen die „Engramme“ genügend starke Eindrücke hinterlassen, um die Keimzellen zu erfassen und damit Erblichkeit der gewonnenen Eindrücke, also der der ausgebildeten „Anlage“ herbeizuführen. Wann diese besonderen Umstände eintreten, läßt sich von vornherein natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Nur darüber läßt auch Semon keinen Zweifel, daß die Erblichkeit sich nur in den seltensten Fällen einstellt.
Die Wage des fachmännischen Urteils neigt sich also wohl immer mehr zugunsten Weismanns, und damit werden auch die Meinungen derjenigen bestätigt, die nicht sowohl an der Hand naturwissenschaftlicher Spezialuntersuchungen als vielmehr auf dem Wege spekulativer Erwägungen längst zu demselben Ergebnis gelangt waren. Ich weiß nicht, ob man darauf geachtet hat, daß Kant die Theorie Weismanns schon ganz deutlich ausgesprochen hat, in einer Zeit, als man von moderner Biologie noch nichts wußte (534).
„Diese Vorsorge der Natur„, schreibt Kant, „ihr Geschöpf durch versteckte innere Vorkehrungen auf allerlei künftige Umstände auszurüsten, damit es sich erhalte und der Verschiedenheit des Klimas oder des Bodens angemessen sei, ist bewunderungswürdig und bringt bei der Wanderung und Verpflanzung der Tiere und Gewächse, dem Scheine nach, neue Arten hervor, welche nichts anderes als Abartungen und Rassen von derselben Gattung sind, deren Keime und natürliche Anlagen sich nur gelegentlich in langen Zeitläufen auf verschiedene Weise entwickelt haben.
„Der Zufall oder allgemeine mechanische Gesetze können solche Zusammenpassungen nicht hervorbringen. Daher müssen wir dergleichen gelegentliche Auswickelungen als vorgebildet ansehen. Allein selbst da, wo sich nichts Zweckmäßiges zeigt, ist das Vermögen, seinen besonderen angenommenen Charakter fortzupflanzen, schon Beweis genug, daß dazu ein besonderer Keim oder natürliche Anlage in dem organischen Geschöpf anzutreffen gewesen. Denn äußere Dinge können wohl Gelegenheits- aber nicht hervorbringende Ursachen von demjenigen sein, was notwendig anerbt und nachartet. So wenig als der Zufall oder physich-mechanische Ursachen einen organischen Körper hervorbringen können, so wenig werden sie zu seiner Zeugungskraft etwas hinzusetzen, d. i etwas bewirken, was sich selbst fortpflanzt, wenn es eine besondere Gestalt oder Verhältnis der Teile ist. Luft, Sonne und Nahrung können einen tierischen Körper in seinem Wachstum modifizieren, aber diese Veränderung nicht zugleich mit einer zeugenden Kraft versehen, die vermögend wäre, sich selbst auch ohne diese Ursache wieder hervorzubringen, sondern, was sich fortpflanzen soll, muß in der Zeugungskraft schon vorher gelegen haben, als vorher bestimmt zu einer gelegentlichen Auswickelung, den Umständen gemäß, darin das Geschöpf geraten kann und in welchen es sich beständig erhalten soll.“
Mir scheinen die Kantschen Worte so prächtig und in ihrer Schlichtheit so überzeugend, daß sie für jedermann — selbst, wenn er nie etwas von den Ergebnissen der Weismannschen Forschungen gehört hätte — das Problem einwandsfrei und endgültig lösen, Unlängst hat wieder Julius Schultz in geistvoller Weise dargetan, wie in der Tat die Annahme einer ewig sich gleichenden Form des Lebendigen auch unserer Sehnsucht nach einheitlicher Erfassung der Welt am ehesten gerecht wird.
Aber auch unter den Anthropologen und Ethnologen gibt es heute kaum noch namhafte Forscher, die die Konstanz der Menschentypen wenigstens für die historische Zeit leugnen. Man darf ohne weiteres annehmen, daß es die herrschende Meinung ist, wenn der außerordentlich vorsichtige Joh. Ranke sich dahin äußert (585): „Soweit uns die Geschichte in die Vorzeit zurückblicken list …. finden wir sichere Anzeichen dafür, daß damals schon die gleichen Unterschiede zwischen den verschiedenen Völkern und Rassen bestanden haben, wie sie uns heute entgegentreten, G. Fritsch hat mit Überzeugung diese Übereinstimmung der ältesten ägyptischen Porträtdarstellungen mit den heutigen in und um Ägypten lebenden Menschengruppen erst neuerdings hervorgehoben.
Wenn, angesichts dieser außergewöhnlich weitgehenden Übereinstimmung der verschiedenen an erster Stelle zum Urteile berufenen Wissenschaften, gelegentlich doch immer wieder ganz wilde Theorien von Rassenbildung in jüngsthistorischer Zeit aufgestellt und — was die Hauptsache ist — mit der Anpassung der Individuen an das neue Milieu erklärt werden (so ist es eine beliebte Vorstellung, daß in den Vereinigten Staaten eine „neue Rasse“ durch das neue Milieu geschaffen werde), s0 fragt man sich, wenigstens wenn es sich um sonst schätzbare Gelehrte handelt; ob denn nicht irrtümliche Auffassungen von dem, worauf es ankommt, Mißverständnisse, falsche Fragestellungen an derartigen handgreiflichen Irrtümern schuld sind. Und findet den Verdacht auch in zahlreichen Fällen bestätigt.
Ein besonders lehrreiches Beispiel für derartige Verfehlungen bildet das vielgelesene Buch des Franzosen Jean Finot, das den suggestiven — um nicht zu sagen tendenziösen —Titel führt: Das Rassenvorurteil. Für Finot ist der Rassenbildungsprozeß ein höchst einfaches Ding: nimm eine beliebige Menge Menschen – Neger, Eskimos, Franzosen, Schweden —, setze sie in ein neues Milieu, und schon in der ersten Generation ist eine „neue Rasse“ da. „Der perfekte Italiener in zehn Stunden.“ Nun merkt man aber bald, daß Mons. Finot in der Tat den Kern des Problems ganz und gar verkannt hat. Das erweisen Ausführungen wie diese wohl zur Genüge: auf Seite 196f. der deutschen Übersetzung seines Buches führt er uns den Einfluß vor Augen, den das Pariser Milieu ausübt, um zu zeigen, wie rasch sich eine neue „Rasse“ — eben der „Pariser“ bildet; eine neue Rasse: also doch wohl eine Gruppe mit besonderen vererblichen Merkmalen. Und dann schließt er diesen Abschnitt mit den Worten: „bemerken wir jedoch, daß dieselben Pariser, wenn sie in die Provinz übersiedeln, leicht ihre Körpergröße, Gesundheit und Langlebigkeit wiedererlangen“ !!
In anderen Fällen merkt man, daß der Autor einen Einfluß, der auf Mischung oder Auslese zurückzuführen ist, dem Milieu zuschreibt und dort von „Vererbung erworbener Eigenschaften“ spricht, wo blutsmäßig begründete Eigenschaften auf einem der beiden anderen genannten Wege hervortreten oder verschwinden. Solchen Irrtümern gegenüber mag noch einmal ausdrücklich bemerkt werden, daß natürlich Veränderungen in der Eigenart eines Volkskörpers — seien sie somatischer, seien sie psychischer Natur — sehr wohl auch in historischer Zeit und sogar in recht beträchtlichem Umfange vor sich gehen können. Wenn man von einer „neuen Rasse“ in den Vereinigten Staaten spricht, s0 ist diese (wenn auch einstweilen wohl kaum schon vorhanden, so doch jedenfalls) sehr wohl denkbar: durch Kreuzung verschiedener Völkerstamme einerseits, durch Auslese bestimmter Typen aus der Masse des einzelnen Volkes anderseits. Ich wies schon an anderer Stelle darauf hin, daß auf dem Wege der Auslese sich das Gesamtbehaben eines Volkes in verhältnismäßig kurzer Zeit von Grund auf verändern kann. Aber man soll sich doch klar darüber sein, daß gerade durch diesen Ausleseprozeß die Konstanz der Blutsqualität außer allen Zweifel gestellt wird; ausgelesen kann doch nie und nimmer etwas werden, das nicht vorher vorhanden gewesen ist. Und auch durch veränderte Lebensbetätigung, wie ich auch schon ausgeführt habe, kann sich das Behaben eines Volkes natürlich andern: aber nicht weil „erworbene Eigenschaften“ erblich geworden wären, sondern weil vorhandene Anlagen jetzt ausgebildet werden, andere früher genutzte Anlagen jetzt verkümmern.
* * *
Wenn ich nun nach diesen Härenden und allgemein wegweisenden Darlegungen im nächsten Kapitel die jüdische Eigenart „genetisch“ zu deuten mich unterfange, so wird mein Bestreben darauf gerichtet sein müssen, der Reihe nach folgende Momente auf ihren Einfluß hin zu prüfen:
- Die ursprüngliche Veranlagung derjenigen Rassen, aus denen sich das jüdische Volk gebildet hat, wie wir sieaus einer Würdigung der Lebensbedingungen, in die wir sie uns versetzt denken müssen, zu erkennen vermögen.
- Die Vermischung dieser verschiedenen Elemente.
- Die Auslese, wie sie unter der Einwirkung der Lebensschicksale des jüdischen Volkes in historischer Zeit sich wahrscheinlich vollzogen hat. Und erst wenn diese drei Erklärungsgründe versagen, dürfte die Hypothese gewagtwerden, daß
- in historischer Zeit bestimmte Eigenschaften erworben seien. Wir werden sehen, daß diese Hilfskonstruktion nicht nötig ist, daß sich vielmehr das jüdische Wesenrestlos aus den drei ersten Momenten erklären Ist. Ist das aber möglich, so ist damit auch die blutsmäßige Verankerung dieses Wesens erwiesen, und es entfällt die an sich sehr unwahrscheinliche Hypothese, daß die durch Jahrtausende sich gleich bleibende Eigenart eine bloße Übung gewesen sei, von der das Blut nichts gewußt habe.
Impressum