14. Kapitel: Das Schicksal des jüdischen Volkes 1911: Die Juden und das Wirtschaftsleben von Werner Sombart: Dritter Abschnitt Wie jüdisches Wesen entstand
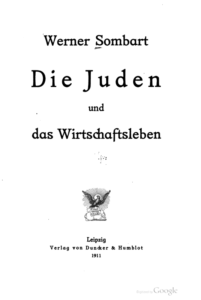
Wollte man die welthistorische Bedeutung der Juden, insbesondere für das Wirtschaftsleben, mit einem Satze erklären und begründen, so müßte man sagen: das ist es, daß ein orientalisches Volk unter Nordlandsvölker verschlagen wurde und mit diesen eine Kultur-Paarung einging. Man hat behauptet (und vielerlei spricht für diese Hypothese, die geistvoll und anmutig zugleich ist); die eigentümlichen Kulturen des klassischen Altertums, vor allem die griechische, ebenso wie die der italienischen Renaissance seien aus einer Vereinigung nordischer Völker, die in jenes Milieu herabgestiegen seien, mit den dort ansässigen Völkern hervorgegangen.
Keine Hypothese, sondern eine durch die Tatsachen sicher gestellte Annahme ist es, das umgekehrt die sogenannte kapitalistische Kultur unserer Zeit durch das Zusammenwirken eben der Juden, eines in nordische Lander vorgedrungenen Südlingsvolkes, mit den hier einheimischen Menschen ihr eigenartiges Gepräge erhalten hat. Wollen wir auch noch den Anteil der beiden Parteien an dem gemeinsamen Werk bestimmen, so werden wir sagen dürfen, daß die überaus große kommerzielle Begabung der Juden und die ebenso, wie es scheint, einzige wissenschaftlich-technische Befähigung der nordischen Völker vornehmlich wohl der Germanen — in ihrer Vereinigung jene ganz Kuriose Blüte der kapitalistischen Kultur getrieben haben.
Das also ist es, was wir im Auge behalten müssen, wenn wir das jüdische Volk in seiner Eigenart und die gewaltige Wirksamkeit dieser Eigenart verstehen wollen: nicht ob es Semiten oder Hethiter oder sonst ein besonders benamster Stamm sind, oder ob sie „rein“ oder „gemischt“ sind, ist das Entscheidende, sondern allein dies: daß es ein orientalisches Volk ist, das in einer ihm völlig fremden klimatischen und volklichen Umgebung seine besten Kräfte verzehrt.
Ein orientalisches Volk. Genauer: eines von jenen Völkern, die zwischen dem Atlasgebirge im Westen und dem persischen Golf im Osten groß geworden sind; die sich aus jenen Rassen gebildet haben, die in den großen Wüsten Nordafrikas, Arabiens und Kleinasiens oder an deren Rändern von einer glühenden Sonne, in einer trocken-heißen Luft ausgekocht worden sind: die in einer mindestens wohl seit der Eiszeit unveränderten ganz eigenartigen Umgebung ihre Besonderheiten ausgebildet haben, wozu sie also nach den Schätzungen von Forel etwa 12000 Jahre, nach denen von Heim etwa 16000 Jahre Zeit gehabt hätten.
Das Gebiet, dem auch die Juden entstammen, ist eine einzige große Sandwüste, in die sich einzelne wasserreiche Stellen einbetten, in denen Menschen und Vieh leben können: die Oasen. In den größeren dieser zerstreuten Wasserbecken haben sich, wie wir wissen, die ersten hohen Kulturen der Menschheit entwickelt: in Ägypten, in Mesopotamien, in Palästina. Das sind alles kleine fruchtbare Gebiete, die durchaus — auch ihrer Größe nach — den Charakter von Oasen in der Wüste tragen. Ihre Kultur ist die spezifische Oasenkultur. Das anbaufähige Land umfaßt in Ägypten etwa eine Fläche von der Größe der preußischen Provinz Sachsen, Mesopotamien war in der Blütezeit etwa halb so groß wie Oberitalien, das gesamte, von Israeliten bewohnte Palästina aber hatte höchstens die Größe des Großherzogtums Baden, während Judaea, das Land, das als Stammsitz des Judentums doch eigentlich nur in Frage kommt, 4000 qkm umfaßte, also etwa so groß wie das Herzogtum Anhalt und das Herzogtum Sachsen-Koburg-Gotha zusammen war. Diese kleinen Oasen, wenigstens die Heimat der Juden: Palästina, waren nun aber selbst wieder noch von Wüsten durchzogen. Juda war von der Natur am wenigsten begünstigt. Nach Süden reichte sein, der menschlichen Kultur erschlossenes Gebiet weit über Hebron und Bersaba in die heutige Wüste hinein.
Bodenanbau in diesen Ländern heißt Oasenkultur. Wie die Oase großenteils künstlich angelegt wird, und wie alles Wissen und alles Können sich in der Kunst erschöpft, das für den Pflanzenwuchs notwendige Wasser zu sammeln, so beruht auch in jenen größeren Fruchtlands-Enklaven, zu denen Teile von Palästina gehörten, alle Bodenkultur auf der Wasserbeschaffung. Der Landmann zittert vor der größten Plage: der Dürre, zittert davor, daß die Wüste ihre Arme über das kleine, ihr mühsam abgerungene Fleckchen Erde jedes Jahr von neuem ausstrecke. Er zittert vor der Wüste in jedem Augenblick, daß sie ihm die heißen, versengenden Winde oder die Heuschreckenzüge sende. Er zittert aber auch vor der Wüste — s0 wenigstens müssen wir uns den Zustand der früheren Zeit vorstellen —, daß aus ihr Beduinenstämme hervorbrechen könnten, die raubend, mordend, plündernd durch die Lande ziehen oder auch das Land, wenn es ihnen paßt, dauernd in Besitz nehmen möchten. Diese Wüstenbewohner im eigentlichen Sinne, die wir heute Beduinen nennen, und zu denen einstmals auch die Oesenbewohner gehört hatten, die nun vor ihren Razzias zittern, sind umherschweifende Viehzüchter, Nomaden, Ihren Räubereien danken die Oasenländer die frühzeitige Erbauung fester Städte mit dicken Mauern, hinter denen die Bewohner des flachen Landes Schutz suchten. In ihnen dringt dann die Wüste selbst wieder in das Herz der wüstenumschlossenen Fruchtlander ein, die also gleichsam wie mit Wüstengeist immerfort durchsetzt bleiben.
Ein solcher ruhelos umherirrender Beduinenstamm waren nun auch jene Hebräer, die etwa um das Jahr 1200 v. Chr. raubend und mordend in das Land Kanaan einbrachen und beschlossen, hier von ihrem ewigen Wandern auszuruhen. Das heißt: wenn möglich nichts zu tun und die stammeingesessene Bevölkerung für sich arbeiten zu lassen (das natürliche und selbstverständliche Streben jedes erobernden Volkes!). So verheißt es Jahve seinem Volke: Ich führe Dich in das Land, das ich Deinen Vätern gelobt und gebe Dir „große und schöne Städte, welche Du nicht gebauet, und Häuser voll von allem Gut, die Du nicht gefüllet, und gehauene Brunnen, welche Du nicht gehauen, Weinberge und Olgarten, welche Du nicht gepflanzet, und Du issest und wirst satt“ (Deut. 6. 10. 11).
Was taten nun die Hebräer in diesem Lande, das ihnen Jahve verhießen? Wie richteten sie — was die Hauptsache blieb — ihr Wirtschaftsleben ein? Wir vermögen es natürlich nicht mit Bestimmtheit zu sagen es nur vermuten können wir einiges. So — wie wir schon sahen — daß die Mächtigen und Großen eine Art von Fronhofwirtschaft organisierten, was natürlich die Besitzergreifung größerer Landstrecken zur Voraussetzung hatte.
Wir dürfen annehmen, daß der erobernde Stamm solcherweise den größten Teil des Landes sich abgabenpflichtig machte, sei es auf dem Wege der Fronpflichtigkeit, sei es (ein offenbar häufiger Fall) auf dem Wege der Verpachtung, sei es durch den Kreditnexus, und daß jedenfalls erhebliche Teile der Hebräer als Renten- oder Zinsherren in den Städten saßen, während die unterjochte Bevölkerung als Kolonen oder „freie“ Bauern das Land bebaute, also „Ackerbau trieb“ oder was man so im Orient nennt. Immerhin mögen auch Teile des erobernden Stammes verarmt und in das Kolonenverhältnis hinabgesunken sein: die maßgebenden waren es jedenfalls nicht. Das waren die Zinsherrn oder auch noch weiter am Hirtenleben festhaltende Nomaden oder Halbnomaden. Dieses waren und blieben wohl ausschließlich dem Berufe nach jene Stämme, die im Süden des westjordanischen Landes saßen, also vor allem Juda sowie Reste von Simeon und Levi nebst einigen Negebstammen: die Naturbedingungen des Landes gestatteten nur die Viehzucht. „Weiß sind Judas Zähne von Milch.“ Andere Stämme wie Ruben und Gad blieben als viehzüchtende Halbnomaden auf dem Ostjordanlande, der halbe Stamm Manasse wanderte dorthin über den Jordan wieder zurück. Aber der Geist des Nomadismus muß in allen Stämmen rege geblieben sein. Denn wenn es anders gewesen wäre, wenn Israel auch nur im Sinne des Orients ein „ackerbautreibendes“ Volk geworden wäre, so würden wir die Entstehung und erste Gestaltung des jüdischen Religionssystems nimmermehr verstehen können.
Wir dürfen doch nicht vergessen, daß die Religionsschriften, in denen der jüdische Glaube festgelegt wird, namentlich also der Pentateuch, durchaus im Sinne eines Nomadenvolkes abgefaßt sind. Der Gott, der sich siegreich gegen die anderen falschen Götter durchsetzt: Jahve, ist ein Wüsten- und Hirtengott, und in der bewußten Aufrichtung des Jahvekultus werden die alten Traditionen des Nomadentums durch Esra und Nehemia unter Nichtbeachtung der dazwischenliegenden (für die Israeliten selbst freilich vielleicht nie vorhanden gewesenen) Ackerbauperiode ganz deutlich zur Richtschnur genommen. Der Priesterkodex „hütet sich vor jeder Hinweisung auf das ansässige Leben im Lande Kanaan … er hält sich formell streng innerhalb der Situation der Wüstenwanderung und will allen Ernstes eine Wüstengesetzgebung sein“ (587). Nehmen wir die historischen Bücher, die meisten Propheten — diesen Wüstenchor — auch noch die Psalmen dazu; überall treten uns die Bilder und Gleichnisse aus dem Hirtenleben entgegen, nur äußerst selten sehen wir den Bauern im Hintergrunde, „der genügsam vor seiner Hütte unter dem Feigenbaum sitzt„. Jahve ist der gute Hirte (Ps. 23), der den Rest Israels zusammentun wird wie Schafe in den Pferch (Mi. 2. 12). Das Sabbatjahr hat auch den Sinn: daß man aufhört, Bauer zu sein und wieder sich als Israelite alten Stiles fühlt.
Israel hat auch seine Gliederung nach Familien und Geschlechtern nie aufgegeben und hält nach Stämmen zusammen, wie Hirten tun: Die Affinitas weicht nie ganz der Propinquitas. Sodaß wir nicht daran zweifeln dürfen, daß noch im 5. Jahrhundert v. Chr. — sonst wären, wie gesagt, alle die Vorgänge in jener Zeit, wäre vor allem die Zusammenschweißung der jüdischen Religionsbücher nicht denkbar — starke, wenn nicht vorwiegend nomadische Instinkte und Neigungen jedenfalls in den maßgebenden Kreisen, aber doch schließlich auch in breiten Schichten des jüdischen Volkes vorhanden gewesen sind, da ohne diese die ganz und gar nomadistisch orientierte Religion dem Volk auf die Dauer nicht hätte aufoktroyiert werden können.
War diese starke Hinneigung zum Nomadismus in jener Zeit nicht aber vielleicht eine Rückbildungserscheinung: Waren vielleicht die nomadischen Instinkte, die im Lauf der vorhergegangenen Jahrhunderte zurückgedrängt waren, unter dem Einfluß des Exils wieder lebendig geworden: Das ist sehr wohl denkbar. Und ich möchte nun diesen Umstand besonders betonen: daß die Schicksale des jüdischen Volkes seit den Exilen, notwendig eine Wiederbelebung verschwindender oder eine Stärkung der noch vorhandenen Wüsten- und Nomadeninstinkte im Gefolge haben mußten, Also auch wenn wir bis zu jener Zeit (in dem halben Jahrtausend, das seit der Eroberung Kanaans verflossen war) eine teilweise Seßhaftwerdung der Kinder Israels anzunehmen geneigt wären, so müsten wir doch feststellen, daß alle Mächte sich dagegen verschworen zu haben scheinen, sie zur Wirklichkeit und zu einem Dauerzustande werden zu lassen. Kaum daß die Pflanze Wurzel schlagen will (soweit sie das auf jenen heißen Ländern überhaupt vermag), wird sie wieder aus dem Boden gerissen. Unbildlich gesprochen: der ursprünglich den Hebräern im Blute steckende Nomadismus und Saharismus (wenn man dieses symbolische Wort gebrauchen darf, um Wüstenhaftigkeit zu bezeichnen) wird im weiteren Verlauf der jüdischen Geschichte durch Anpassung oder Auslese erhalten und immer weiter gezüchtet. Sodaß wir als das Schicksal des jüdischen Volkes dieses bezeichnen können: daß es durch die Jahrttausende hindurch ein Wüstenvolk und ein Wandervolk geblieben ist.
Diese Feststellung ist nicht neu. Und sie zu machen, ist nicht ohne Bedenken, weil antisemitische Pamphletisten aus dieser Tatsache in gehässiger Weise Stoff für ihre Schimpfereien entnommen haben. Das kann aber natürlich kein Grund sein, die Richtigkeit der Tatsache selbst in Zweifel zu ziehen oder sie als Erklärung der jüdischen Eigenart nicht in Berücksichtigung zu nehmen. Was man angesichts der kompromittierenden Ausnutzung des Gedankens durch die Tendenzschriftstellerei (Dühring, Wahrmund usw.) nur tun kann, ist eine gewissenhafte Prüfung des Tatsachenmaterials, ist vor allem eine einigermaßen sinnvolle Begründung der Wichtigkeit jener Feststellung. Was darin bisher geleistet worden ist, ist läppisch und gehässig entstellt und gibt den Gegnern freilich fast das Recht, mit Hohn und Spott den „Gedanken vom ewigen Nomadentum“ der Juden als absurd zurückzuweisen und zu sprechen von dem „merkwürdigen Einfall vieler Rassengläubiger, die Semiten, Nomaden zu schimpfen“ (Hertz).
Freilich wäre es besser gewesen, wenn diejenigen, die den „Einfall“ für „merkwürdig“ hielten, sich doch, statt sich zu entrüsten, im Grunde bemüht hätten, ihn als falsch zu erweisen. Denn das ist bisher noch niemals versucht worden, da der Schluß: „In Palästina wurde im Altertum Ackerbau getrieben, die Juden haben Palästina in jener Zeit bewohnt, also sind sie Ackerbauer — oder wie man sich wohl gelegentlich drastisch ausdrückt: Agrarier — gewesen“, doch ein wenig klapprig in seinem Gefüge ist. Auch wenn z. B. Hertz in seinem vortrefflichen Buche dem Gedanken Ausdruck gibt, daß die Stadt an den Boden binde und die Seßhaftigkeit erzwinge, „was weder das leichte Holzhaus noch der Pflug vermag“ (der westfälische Bauer nicht „seßhaft„, wohl aber der Berliner in der Zweizimmerwohnung!), so wird er für solche Aussprüche selbst bei seinen allerbesten Freunden nicht auf unbedingte Zustimmung rechnen dürfen.
Endlich noch dieses zur Klarstellung: in der schlichten Tatsache, daß man jemanden einen „Nomaden“ nennt, liegt keinerlei Geringschätzung ausgedrückt: ich weise deshalb auch die Bezeichnung „Nomaden schimpfen“ als unberechtigt zurück. Höchstens könnte man eine Beleidigung in dem Worte erblicken, wenn man damit die Vorstellung des „Raubes“, der ewigen „Razzia„, verbindet und den Nomadismus mit Razziantentum gleichsetzt. Aber selbst dann: Warum sollte ein forscher Beduinenstamm unter einem Anführer etwa nach Art des Königs David, selbst wenn er wie dieser von räuberischen Überfallen lebt, nicht ebenso „wertvoll“ sein und ebensoviel Sympathie erwecken wie ein ackerbautreibender, seßhafter Negerstamm in den Wäldern Afrikas? Von den „Werturteilen“ ist hier aber nicht zu reden; ich habe meine Ansicht darüber im Vorwort ausgesprochen. Daß das Wort „Nomade“ für die spätere Zeit der jüdischen Geschichte in übertragenem Sinne gebraucht wird, versteht sich wohl von selbst. Und nun — nach diesen vielen Kautelen — versuchen wir die Richtigkeit der Tatsache zu erweisen: die Juden ein ewiges Wüsten-Wandervolk durch Anpassung oder Auslese.
Wie das Exil die nomadischen Instinkte wieder zur Belebung brachte, wurde schon angedeutet. Das Exill von dem wir uns — wenn wir ehrlich sein wollen — eigentlich gar keine deutliche Vorstellung machen können. Weder vom Hinausmarsch noch von der Zurückführung. Recht wahrscheinlich wird die ganze Bewegung überhaupt erst, wenn wir uns in jener Zeit die Kinder Israels insgesamt noch als Nomaden oder Halbnomaden vorstellen. Die Eroberung eines Ackerbauvolkes ist ja kaum recht denkbar; während zwangsweise Versetzungen von Nomadenstämmen heute noch üblich sind. Sie gelten heute noch als „ein starkes Werkzeug der Machthaber an den Steppengrenzen, das besonders Rußland zu handhaben versteht“ (588). Mit der Auffassung, daß zur Zeit des Exils die Israeliten noch vorwiegend Viehzucht trieben, würde auch der Bericht zusammenstimmen, den wir über die Fortführung aus Palästina besitzen: „Und er führete ganz Israel und alle Obristen und alle Kriegsleute hinweg, zehntausend wurden weggeführt und alle Schmiede und Schlosser; nichts blieb übrig außer geringem Volke des Landes“. Und wiederholt: „Alle Vornehmen des Landes führte er gefangen hinweg von Jerusalem gen Babel und alle Kriegsleute, siebentausend, und die Schmiede und die Schlosser, tausend, alles Streitbare, zum Kriege taugliche, die brachte der König von Babel gefangen gen Babel“. Dann bei der zweiten Razzia: „Und den Rest des Volkes, die Übriggebliebenen in der Stadt, und die Überläufer, die übergegangen zum König von Babel und den Rest der Volksmenge (führte er weg). Von den Geringen aber im Lande ließ der Oberste der Scharfrichter zurück zu Winzern und Ackerleuten, (II. Reg. 24, 14. 15; 25, 11. 12). Diesen Bericht bestätigt in seiner Richtigkeit Jeremias (89, 10): „Aber vom Volke die Geringen, die nichts hatten, ließ Nebusaradan, der Oberste der Trabanten, zurück im Lande Juda und gab ihnen Weinberge und Aecker zu selbiger Zeit„
Wen man sich nun auch unter den Exilierten vorstellen mag: die eigentlichen Landleute waren nicht darunter. Die blieben vielmehr auch nach dem zweiten Abhub als Bodensatz zurück: die Stelle bei Jeremias scheint die Ansicht zu bewahrheiten, die ich oben aussprach: daß das Land von Kolonen oder Fronarbeitern bestellt wurde, die nun, als ihre Herren ins Exil geführt wurden, aus bloßen Bebauern fremden Eigens zu Eigentümern des von ihnen bewirtschafteten Landes wurden. Man kann sich vorstellen, daß dies größtenteils die Residuen der alten Eingeborenenstämme waren, die die Hebräer sich unterworfen hatten. Die Bevölkerung Palästinas (resp. Judaeas) würde dann von da ab in geringerem Grade hebräisches Blut in ihren Adern gehabt haben als die babylonische Judenschaft, die jedenfalls als eine Art von Aristokratie, von abgeschöpftem Rahm, gelten kann. Dies ist auch die Auffassung, die sich während der späteren Jahrhunderte im Judentum lebendig erhält. Selbst in Judaea räumte man den babylonischen Eingeborenen jüdischer Abkunft die lauterste Reinheit der Geschlechter ein. Ein altes Sprichwort sagt: „Die jüdische Bevölkerung in den (römischen) Ländern verhält sich in bezug auf Abstammung gegen jene in Judäa, wie vermischter Teig zu reinem Mehl, Judda aber selbst ist auch nur Teig gegen Babylonien“ (589). R. Juda b. Jecheskeel (220—299) entschuldigt den frommen Esra und dessen Auswanderung aus Babylonien nur damit, daß er die Familien zweifelhafter Abstammung nach Judäa führte, damit die Zurückbleibenden von Vermischung mit ihnen fern gehalten würden (!) (590).
Das Wichtige für unsere Betrachtung ist dieses: das Exil bewirkte eine Auslese von besten Elementen in Juda, die jedenfalls nicht die Träger bodenständiger Tendenzen waren und durch die Exilierung selbst meist von aller etwa noch vorhandenen Bodenständigkeit und Wurzelfestigkeit abgedrängt wurden; die sich in die Zwangslage versetzt sahen, ihr altes Nomadendasein (auch wenn es eingeschlummert war) wieder zu beleben und als Städter (Händler) ihr Dasein zu fristen. (Daß ein Teil der nach Babylonien verschlagenen Juden dort auch Ackerbau trieb, dürfen wir angesichts des babylonischen Talmuds als wahrscheinlich annehmen; aber hier wiederholten sich die Zustände, die wir in Palästina anzutreffen geglaubt haben: städtische Herren, die zugleich Geldverleiher sind, lassen ihr Land durch nichtjüdische?) Teilbauern anbauen: das wenigstens ist das typische Bild, das wir aus dem babylonischen Talmud empfangen, von dem selbstverständlich Ausnahmen vorkommen; wir begegnen selbst Rabbanen, die hinter dem Pfluge hergehen.)
Und was noch wichtiger ist: die Vorgänge des Exils bleiben nicht vereinzelt, sondern werden die normalen, wie man sagen könnte. Schon vor dem Exil hatten zahlreiche Juden in Ägypten und auch in andern fremden Ländern gelebt. Von nun an vollzieht sich dauernd jener Prozeß einer Auslese der nicht bodenständigen, der wenigstens am ehesten mobilisierbaren Elemente durch das freiwillige Exil, die Auswanderung, aus der sich nun die Diaspora bildet. In die Fremde gingen immer diejenigen, in denen das alte Nomadenblut noch am stärksten pochte, und dadurch, daß sie in die Fremde gingen, wurde dieses Blut wieder ganz rege und durchströmte nun wieder ihr ganzes Wesen. Denn daß die aus Palästina (oder Babylonien) freiwillig (oder unter dem Zwang bloß ökonomischer Verhältnisse) auswandernden Juden irgendwo eine Ackerbaukolonie oder auch nur eine dauernde selbständige Niederlassung gegründet hätten (wie wir es von den meisten andern Auswanderer namentlich auch der alten Welt hören): davon erfahren wir nichts. Wohl aber vernehmen wir, daß die auswandernden Juden sich über den ganzen bewohnten Erdkreis unter die fremden Völker verteilen, mit Vorliebe aber in den großen Städten ihre Unterkunft suchen (591). Wir erfahren auch nichts davon, daß jene sich selbst verbannenden Juden etwa zur heimatlichen Scholle zurückgekehrt wären, nachdem sie sich ein kleines Vermögen erworben hatten: wie heute die auswandernden Schweizer oder Ungarn oder Italiener. Sie bleiben vielmehr in den fremden Städten und erhalten mit dem Heimatlande nur geistig religiöse Beziehungen aufrecht. Höchstens daß sie — als echte Nomaden — ihre jährliche Pilgerfahrt nach Jerusalem zum Passahfeste unternehmen.
Allmählich verliert Palästina seine Bedeutung als Heimat der Juden, und das Judentum lebt berwiegend in der Diaspora. Denn schon als der zweite Tempel zerstört wurde (70 n. Chr.), wohnten wohl beträchtlich mehr Juden in der Diaspora als in Palästina selbst. Daß dieses auch in den Zeiten der dichtesten Besiedlung mehr als 1 bis 1½ Millionen Menschen ernährt haben sollte (60—100 auf den qkm; heute beträgt die Bevölkerung höchstens 650 000), ist kaum anzunehmen, Gesamtjudäa aber umfaßte 225 000 Einwohner; Jerusalem 25 000 (592). Mehr Juden lebten aber wohl sicher schon zu Beginn unserer Zeitrechnung außerhalb der Grenzen Palästinas, Im ptolemischen Ägypten allein sollen von 7 – 8 Millionen Einwohnern 1 Million Juden gewesen sein (593). Und es war doch nicht leicht, einen Ort der bewohnten Erde zu finden, welcher nicht von diesem Geschlechte bewohnt und beherrscht (!) war, wie wir Josephus aus Strab0 zitieren hörten. Philo zählt die zu seiner Zeit von Juden bewohnten Länder auf und fügt hinzu: daß sie in zahllosen (xxxxxx) Städten Europas, Asiens und Libyens, auf den Festländern und auf Inseln, am Meer und im Binnenlande angesiedelt seien. Dasselbe hatte schon ein gegen Ende des 2. Jahrhunderts v. Chr. verfaßtes Sibyllenorakel ausgesagt (594) und Hieronymus bestätigt, daß sie, „von Meer zu Meer, vom Britannischen bis zum Atlantischen Ozean, von Westen zu Süden, von Norden zu Osten, auf der ganzen Welt“ wohnten (595). Wie dick sie beispielsweise im frühkaiserlichen Rom schon saßen, bezeugen verschiedene Berichte: eine Gesandtschaft des Judenkönigs Herodes wurde angeblich von 8000 ihrer in Rom ansässigen Glaubensgenossen zu Augustus begleitet und im Jahre 19 n. Chr. wurden 4000 Freigelassene im waffenfähigen Alter, die „vom ägyptischen und jüdischen Aberglauben angesteckt“ waren, zur Deportation nach Sardinien verurteilt (596).
Genug: wie hoch man auch den Anteil der vorchristlichen Diaspora an der Gesamtjudenschaft veranschlagen möge: darüber kann kein Zweifel obwalten, daß Israel schon über die Erde zerstreut war, als der zweite Tempel fiel (597). Und auch das ist zweifellos, daß das Mittelalter den Ameisenhaufen nicht zur Ruhe kommen ließ, daß Israel rastlos über die Erde zog.
Die großen Züge der jüdischen Wanderungen sind diese: seit Ende des 5. Jahrhunderts erst langsame, dann rasche Entleerung Babyloniens in alle Gebiete der Erde: nach Arabien, nach Indien, nach Europa. Seit dem 18. Jahrhundert Abfluß aus England, Frankreich, Deutschland, teils nach der Pyrenäenhalbinsel, in die schon vorher viel Juden aus Palästina und Babylonien gewandert waren, teils in die europäischen Ostreiche, in die seit dem 8. Jahrhundert auch von Südosten her über das Schwarze Meer der Strom aus dem bygantinischen Reiche sich ergoß. Gegen Ende des Mittelalters sind dann die beiden großen Becken die Pyrenäenhalbinsel und Rußland-Polen geworden (soweit sie der Orient nicht behalten hatte). Von da ab beginnt die Neuverteilung der udenschaft, wie wir sie in ihren Hauptzügen verfolgt haben. Zunächst beginnen die Spaniolen, dann — seit den Kosaken verfolgungen im 17. Jahrhundert — die östlichen Juden sich über die Erde zu verbreiten. Dieser Prozeß der Zerstäubung der russisch-polnischen Juden hatte einen ziemlich organischen Verlauf angenommen, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Krater plötzlich wieder große Massen auswarf: jene ungezählten Hunderttausende, die in den letzten Jahrzehnten ihre Zuflucht in der Neuen Welt gesucht haben.
Innerhalb der einzelnen Länder weist dann der Strom der jüdischen Wanderungen wieder seine besonderen Richtungen auf, die beispielsweisen Deutschland auch die von Osten nach Westen ist. Deutschland nahm ja mit der jüdischen Bevölkerung in der Provinz Posen an dem großen Reservoir, das die „östlichen“ Juden enthält, starken Anteil. Noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts (1849), zu der Zeit allerdings, in der die meisten Posenschen Städte, was den Anteil der jüdischen Bevölkerung anbetrifft, ihren Höhepunkt erreichten, gab es doch von 131 Ortschaften 21, deren Einwohnerzahl zu 30—40 % aus Juden bestand, während in 4 Orten 41 – 50 %, in 3 Orten über 50% (bis 64 %) der Bevölkerung Juden waren. In dem letzten halben Jahrhundert ist dann die Judenschaft im Posenschen stark zusammengeschmolzen. 1905 wurden mehr als 10 % Juden nur noch in 10 Städten ermittelt, und der höchste Anteil an der Gesamtbevölkerung überstieg an keinem Orte 15%. Wenn man die Gesamtzahl der Juden in der Provinz Posen im Jahre 1840 mit 100 gleichsetzt, so waren davon im Jahre 1905 nur noch 39,4 zurückgeblieben. Die 30433 Juden, die 1905 in der Provinz Posen ermittelt wurden, machten noch 15% der Gesamtbevölkerung aus, während die 76 757 Juden, die 1849 ebendaselbst geählt wurden, 57 % der Bevölkerung bildeten. Um mehr als 60 % hat also die jüdische Bevölkerung der Provinz Posen in 55 Jahren abgenommen (596).
Aber auch im übrigen Deutschland sind die Juden während des letzten Menschenalters viel gewandert, meist mit dem einen Ziel, Berlin. In den Jahren nur von 1880—1905 betrug für die preusischen
| Provinzen | Zuwanderung | Abwanderung |
| Ostpreußen | – | 8 035 |
| Westpreußen | – | 15 170 |
| Brandenburg | 25 539 | – |
| Stadtkreis Berlin | 29 008 | – |
| Pommern | – | 6 603 |
| Posen | – | 31 381 |
| Schlesien | – | 13 854 |
| Sachsen | – | 958 |
| Schleswig-Holstein | – | 1 043 |
| Hannover | – | 2 934 |
| Westfalen | – | 4 276 |
| Hessen-Nassau | – | 144 |
| Rheinprovinz | – | 1 522 |
| Staat | 54 547 | 85 920 |
Dies durch die Jahrhunderte von Ort zu Ort gehetzte Volk, dessen Schicksal in der Sage vom ewigen Juden seinen ergreifenden Ausdruck gefunden hat (599), wäre schon der ewigen Unruhe wegen niemals zu einem Gefühl der Bodenständigkeit gekommen, selbst wenn es in den Zwischenpausen zwischen zwei Verfolgungen versucht hätte, in der Scholle zu wurzeln.
Aber alles, was wir an sicheren Zeugnissen über die Lebensweise der Juden in der Verbannung besitzen, stimmt dahin überein, daß immer ein verschwindend kleiner Teil sich mit Landbau abgegeben hat, selbst dort, wo ihnen der Betrieb der Landwirtschaft nicht verwehrt war. Am meisten scheinen die sich dem Ackerbau ergeben zu haben in Polen während des 16. Jahrhunderts. Aber auch hier leben sie doch mit Vorliebe in den Städten, Wir erfahren jedenfalls aus jener Zeit, daß auf 500 christliche Großhändler 3200 jüdische in den polnischen Städten entfielen 600.
Städtebewohner wurden sie — ob freiwillig, ob zwangsweise bleibt sich gleich —, Städtebewohner sind sie bis auf den heutigen Tag geblieben: in der Gegenwart leben die Hälfte und mehr der Juden in Großstädten über 50 000 Einwohner in Deutschland (1900: 43,46 %), Italien, Schweiz, Holland, Dänemark (4/5), England (alle), Vereinigte Staaten (alle). Die Großstadt aber ist die unmittelbare Fortsetzung der Wüste — sie steht der dampfenden Scholle ebenso fern wie diese und zwingt ihren Bewohnern ein nomadisierendes Leben auf wie diese.
Durch Anpassung an die Umwelt wurden die alten Keime des Nomadentums und der alten Wüstensinne der Juden während der Jahrtausende entwickelt: und durch Auslese immer mehr zur Vorherrschaft gebracht, denn es ist Kar, daß in dem beständigen Wechsel, dem die Judenschaft ausgesetzt war, nicht die behaglich-bodenständigen, sondern die rastlos-nomadischen Elemente diejenigen waren, die sich am widerstandsfähigsten erhielten und darum überlebten.
Und dieses heiße, unruhevolle Volk, das nicht vierzig Jahre, sondern viertausend Jahre und länger in der Wüste gewandert hatte, kam nun endlich in sein Kanaan: in die Länder, wo es von seinen Wanderungen ausruhen wollte: in die nordischen Lander und begegnete hier Völkern, die selbst die Jahrtausende hindurch, während welcher die Juden von Oase zu Oase geirrt waren, in so ganz und gar verschiedener Umgebung auf ihrer Scholle gesessen hatten: naßkalten Völkern gleichsam, die sich von den Juden abhoben wie ein Ardennenpferd von einem arabischen Rosse.
Man wird jetzt bald nicht mehr viel Wert darauf legen, die Völker, die Nord-, Mittel- und Osteuropa seit Jahrttausenden besiedeln, „Arier“ zu nennen (oder anders). Zwar ergeben die neueren Untersuchungen sowohl auf somatisch-anthropologischem und archäologischem als auf linguistischem Gebiet, daß wenigstens ein großer Teil der Völker, welche in der jüngeren Steinperiode Mittel- und Nordeuropa bewohnten, Arier gewesen sind (601). Aber das ist ja gar nicht so wichtig. Was wissen wir denn viel von dem Grundwesen dieser Völker, wenn wir erfahren, daß es „Arier“ waren: Dann müßten wir ja alle jene mystischen Verirrungen wieder erleben, von denen ich mit Schaudern berichtet habe, wenn wir aus der Sprache oder vielleicht auch aus übereinstimmenden anthropologischen Merkmalen, wie Schädelform usw. auf den geistigen Habitus dieser Menschen schließen wollten. Wichtig und entscheidend ist, daß diese „Arier“ nordische Völker waren, die dem Norden entstammen und in heißen Ländern sich nicht haben akklimatisieren können 8602).
Sie als „Arier“ zu bewerten und verstehen zu wollen, führt geradezu irre; denn dann ist man immer in Versuchung, die dunkeln Inder als Brüder zu betrachten und versperrt sich dadurch sicher den Weg zur besseren Einsicht. Die blonden blauäugigen Menschen, die Nord- und Mitteleuropa seit Jahrtausenden inne haben, haben wahrscheinlich mit jenen braunen Menschen der indischen Jungel, mögen ihre Sprachen auch noch so verwandt sein, blutsmäßig herzlich wenig gemein.
Denn die Eigenart ihres Wesens haben sie nur erwerben können in der ganz eigenen Umgebung, die ihnen die nordischen Länder boten. Welches diese Eigenart war, können wir ja heute noch an uns erfahren, nur müssen wir immer bedenken, daß das spezifisch Nordische in jenen vergangenen Zeiten noch vielausgeprägter war als heute. Will man diese Eigenart in ein Wort fassen, um es der Eigenart der Wüste entgegenzusetzen, so heißt dieses eine Wort: Wald. Wüste und Wald sind die großen Kontraste, um die alle Wesenheit der Länder wie der Menschen, die sie bewohnen, herumgelagert ist. Der Wald gibt dem Norden sein Gepräge; genauer: der nordische Wald, in dem die Bäche murmeln, in dem der Nebel um die Stämme quirlt, in dem die Kröte „im feuchten Moos und triefenden Gestein“ haust, in dem im Winter die matten Sonnenstrahlen im Rauhreif glitzern, und in dem im Sommer die Vögel singen, Wälder rauschten ja auch auf dem Libanon und rauschen heute noch im Süden von Italien, wo längst der Wüstencharakter eingesetzt hat; aber wer jemals in einen südlichen Wald getreten ist, weiß, daß er nicht mehr als den Namen mit unsern nordischen Wäldern gemein hat;
„der wird gestehen müssen, daß dieser Wald (schon in Italien) für Anblick und Gefühl ein anderer ist, als der auf den Alpen oder an dem Gestade der Ostsee. Der süditalienische Wald ist klangvoll, von reinem Licht und Blau durchschimmert in seinem Aufstreben, Beugen und Schaudern elastisch und nervig; oft gleicht er einem Tempelhain.“ (Hehn.)
Während unser nordischer Wald lieblich und gespenstisch, traulich und schreckhaft in einem ist. Wüste und Wald, Sand und Sumpf, das sind die großen Gegensätze, die letzten Endes ja auf dem verschiedenen Feuchtigkeitsgehalt der Luft beruhen und alle anderen für das Menschendasein (wie wir noch sehen werden) so entscheidenden Bedingungen schaffen; hier ist gleichsam das Symbol der Natur die Fata morgana, dort der Nebelstreif.
Und alle Eigenart dieser nordischen Natur, sagte ich, war in früherer Zeit viel stärker ausgeprägt als heute. Die Römer schildern uns Germanien als ein rauhes Land, das von Sümpfen und dichten Wäldern erfüllt ist, als ein Land mit düsterem Himmel, nebelvoller, regenreicher Luft, mit langen Wintern und furchtbaren Stürmen.
Hier hausten nun Völker, wahrscheinlich seit der Eiszeit, deren Spuren wir jedenfalls Jahrtausende zurückverfolgen können. Nach neueren Hypothesen hätten die Germanen auf einer klimatischen Insel in einer Ecke Frankreichs sogar die Eiszeit hier oben überdauert. (Die erste Geschichtskunde von den Germanen, die wir einem römischen Schriftsteller verdanken, stammt aus dem Jahre 330 v. Chr.)
(Aber auch, wenn die ersten Pfahlbaubewohner [die aber möglicherweise paläolithisch sind] aus dem Osten eingewandert sein sollten, so wären sie doch nur aus einem nicht völlig andern Milieu gekommen, nämlich aus dem grasreichen Steppengebiet Zentralasiens.)
Jahrtausende lang, können wir also getrost sagen, saßen hier Rassen und Völker (die unsere Vorfahren sind) in feuchten Wäldern, zwischen Sümpfen, zwischen Nebeln, in Eis und Schnee und Regen, womöglich auf Pfahlrosten im Wasser selbst. Und rodeten die Wälder und machten das Land urbar und siedelten dort, wo ihnen Axt und Pfugschar einen Streifen in der Wildnis frei gemacht hatten. Auch als diese Stämme noch nicht völlig zur Seßhaftigkeit gelangt waren (und die Berichte des Caesar lassen darauf schließen, daß damals noch Jagd und Viehzucht die Hauptbeschäftigung waren, und daß sie ihre Aufenthalte von Zeit zu Zeit wechselten), erscheinen sie uns doch schon gleichsam mit dem Boden verwachsen, Ganz hat der Ackerbau nie gefehlt: aus den linguistischen Tatsachen ergibt sich mit Bestimmtheit, „daß keiner Epoche der indogermanischen Vorgeschichte der Feldbau ganz unbekannt gewesen sein kann. Die ältesten Pfahlbauer, die wir kennen, waren schon Ackerbauer. Aber auch dort, wo wir uns jene nordischen Völker als „Nomaden“ vorstellen, ist das Bild ganz und gar ein anderes als das, das wir uns von einem Beduinenstamme machen und empfinden wir sie bodenständiger als selbst ein Ackerbauvolk in einem Oasenlande. Jene sind immer Siedler, auch wenn sie Viehzucht treiben; diese immer Bodenfremde, auch wenn sie Ackerbauer sind.
Das macht der Umstand, daß doch das Verhältnis im Norden mit der Natur ein innigeres ist als in den heißen Ländern. Man bettet sich gleichsam in die Natur ein, auch wenn man nur als Jäger durch die Wälder streift oder als Hirt für seine Herde in das Dickicht eine Lichtung schlägt. Ich möchte (auf die Gefahr hin, als „moderner Mystiker“ verspottet zu werden), sagen: daß im Norden auch zwischen dem gewöhnlichen Menschen und der Natur sich zarte Bande der Freundschaft und Liebe knüpfen, die der Bewohner heißer Zonen, die schon der Italiener kaum noch in gleichem Maße kennt. Im Süden, hat man oft mit Recht bemerkt, betrachtet der Mensch die Natur nur unter dem Gesichtspunkt des Kulturzweckes. Der Mensch bleibt der Natur innerlich fremd, selbst wenn er das Land bebaut; ein eigentliches Landleben: ein Leben in der Natur und mit der Natur, ein Verwachsensein mit Baum und Strauch, mit Land und Wiese, mit Wild und Vögeln gibt es nicht in jenen seligeren Gefilden.
* * *
Sollte nun diese grundverschiedene Umgebung, sollte die durch die Eigenart der Umgebung grundverschieden gestaltete Lebensweise nicht das Wesen dieser Menschen selber in je einer besonderen Richtung bilden? Sollte also auch die jüdische Eigenart, wie wir sie kennen gelernt haben, nicht beeinflußt worden sein, ja geradezu ihr charakteristisches Gepräge empfangen haben durch die Jahrtausende währende, gleichförmige Wüstenwanderung?
Wenn ich die Frage mit ja beantworte und im folgenden versuche, jenen Zusammenhang zu begründen, so muß freilich eingestanden werden, daß ein „exackter“ Beweis — und das müßte ein biologischer sein — für die Richtigkeit meiner Annahme bei dem heutigen Stande unseres Wissens nicht geführt werden kann. Dazu fehlen einstweilen noch alle empirisch-experimentellen Unterlagen, die uns darüber Aufschluß geben könnten, wie die Eigenart der Umgebung und der Lebensbetätigung die anatomische und physiologische Art der Menschen und damit auch ihre psychische Beschaffenheit beeinflussen, In welcher Richtung diese Untersuchungen angestellt werden müßten, dafür gibt uns Juan Huarte de San Juan, jener kluge, spanische Arzt aus dem 16. Jahrhundert, den ich schon erwähnt habe, wertvolle Fingerzeige in seinem genialen Examen de ingenios, in dem er auch (der einzige bisher!) einen ernsthaften Versuch macht, die jüdische Eigenart aus der Vergangenheit und den Schicksalen des jüdischen Volkes biologisch psychologisch zu erklären. Die Gedanken dieses ausgezeichneten Mannes, der, oft in einer für seine Zeit geradezu hellseherischen Weise, Probleme der menschlichen Artbildung behandelt, erscheinen mir wertvoll genug, um sie der unverdienten Vergessenheit zu entreißen und sie an dieser Stelle auszugsweise mitzuteilen (603).
Huarte führt die Eigenart des jüdischen Geistes auf folgende Bedingungen zurück, unter denen die Juden groß geworden sind:
- 1. die heißen Klimata,
- 2. die unfruchtbaren Gegenden;
- 3. die eigentümliche Ernährung, die sie namentlich in der Wüste während ihrer 40 jährigen Wanderung gehabt haben.
Während dieser Zeit genossen sie eine ganz feine Speise: das Manna; tranken ganz leichtes Wasser und atmeten eine ganz feine Luft. Dadurch wurde in den Männern ein feiner und verbrannter Same abgesondert; in den Frauenspersonen bildete sich ein zartes und reines (sutil y delicada) monatliches Blut: das bewirkt aber schon nach Aristoteles, daß scharfsinnige Kinder geboren wurden: hombre de muy agudo ingenio.
- 4. „Als aber das israelitische Volk in den Besitz des ihm verheißenen Landes nunmehr gesetzt war, so mußte es bei seinem …… 30 scharfsinnigen Genie so viel Mühseligkeiten, Teuerungen, feindliche Einfälle, Unterwerfungen, Knechtschaften und Verfolgungen ausstehen, daß es durch dieses elende Leben jenes warme, trockene und verbrannte Temperament (aquel temperamento caliento y seco y retostado) erhielt ……. Eine beständige Traurigkeit und ein beständiges Elend macht, daß sich dieLebensgeister und das Pulsaderblut sowohl in dem Gehirn als in der Leber und in dem Herzen häufen und sich endlich, weil immer mehr und mehr dazu kommen, untereinander verbrennen und verzehren …… Das Gewöhnlichste ist, daß sie viel schwarze und verbrannte Galle (melancolia por adustion) erzeugen. Von dieser schwarzen Galle haben fast alle Juden noch bis jetzt sehr vieles …… „metus et maestitia diu durans melancholiam significat“ (Hippocrates). Diese verbrannte Galle (esta célera retostada) ist ……. das Werkzeug der Verschlagenheit, derList und der Bosheit (solercia, astucia, versacia, malicia). Sie macht aber auch zu den medizinischen Vermutungen sehr geschickt usw. Der Verfasser widerlegt dann noch den Einwand: die Juden hätten in den 3000 Jahren, seit sie Manna nicht aßen, die dadurch erworbenen Eigenschaften wieder verloren, mit ernsthaften Erörterungen über „Vererbung erworbener Eigenschaften“ usw. Die Pointe seiner Ausführungen ist diese: was einmal das Keimplasma verändert hat, wirkt lange weiter. Übrigenswill er nicht leugnen, daß eine Abnahme der Scharfsinnigkeit bei den Juden doch vielleicht zu bemerken sei.
In diese Tiefen, in die der Madrider Arzt steigt, wage ich also den Leser nicht zu führen: einstweilen würden wir dort doch auf nichts anderes als auf unbewiesene Tatsachen und laienhafte Vermutungen stoßen. Wir müssen vielmehr notgedrungen an der Oberfläche bleiben und uns im wesentlichen damit begnügen, auf die Zusammenhänge hinzuweisen, die (unserer erlebnismäßigen Erkenntnis gemäß) zwischen bestimmten psychologischen Eigenarten, wie wir sie an den Juden wahrnehmen konnten, und ihren Lebensschicksalen bestehen.
Als diejenige Eigenart des jüdischen Wesens, in die wir alle andern Eigenarten gleichsam eingebettet fanden, wie Samenkörner in die Samenkapsel, erkannten wir die überragende Geistigheit dieses Volkes. Diese aber werden wir wohl ohne jedes Bedenken erklären dürfen aus der Tatsache, daß die Juden von der Urzeit des Hirtendaseins an niemals körperlich schwere oder auch nur vorwiegend körperliche Arbeit zu verrichten gehabt haben, Von dem Fluche, mit dem Adam und Eva aus dem Paradiese gestoßen wurden: daß der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen müsse, haben die Juden in allen Zeiten wenig mitgetragen, wenn wir den körperlichen Schweiß und nicht etwa Sorge und Überlegung — die aber doch nun einmal nur „geistig“ Arbeit in dem gewöhnlichen Verstande verursachen — darunter verstehen wollen. Das Hirtendasein verlegt schon den Schwerpunkt der Tätigkeit in die bedenkende, disponierende, organisierende Arbeit, und alle Berufe, die wir dann die Juden ergreifen sehen (ob zwangsweise, ob freiwillig, bleibt sich in diesem Falle gleich), erheischen nicht eigentlich körperliche Anstrengung, wohl aber geistige Fähigkeiten. Unser aller Stammbaum führt in den allermeisten Fällen spätestens nach zwei oder drei Generationen hinter den Pflug oder der Ambos oder den Webstuhl zurück. Die Juden würden viele Geschlechter nennen können, die seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden nicht Bauern und nicht Handwerker, nicht eigentlich Werkschöpfer, sondern nur Bedenker gewesen sind: „geistige“ Arbeiter. Sollte sich dadurch Anpassung und Auslese der zu solcher unkörperlichen Arbeit Geeignetsten nicht eine besondere Eigenart herausgebildet haben? Es wäre seltsam, wenn es nicht der Fall wäre. Wir müßten ohne weiteres auf eine hervorragende Geistigheit dieser Bevölkerungsgruppe aus ihrem Lebensschicksal schließen. Und wenn wir nun diese Eigenart durch Beobachtung feststellen: sollte dann der Schluß nicht statthaft sein, daß sie aus der besonderen Arbeitssphäre, in die die Juden seit Anbeginn an eingeschlossen waren, sich ableiten lasse?
Aber auch jene besondere Geistigheit, die wir bei den Juden fanden, führt schließlich in die Wüste — Sand- oder Steinwüste — zurück. „Abstrakt„, „rational“ sehen wir sie veranlagt: mit ausgeprägtem Sinn für begrifflich-diskursive Erfassung der Dinge; mit einem Mangel an sinnlicher Anschaulichkeit und empfindungsmäßiger Beziehung zur Welt. Wüste und Wald, Norden und Süden! Die scharfen Konturen heißer trockner Länder, die grellen Sonnenflecke neben den tiefen Schlagschatten, die hellen Sternennächte, die erstarrte Natur: alles dieses läßt sich wohl bildlich in das eine Wort des „Abstrakten“ zusammenfassen, dem das „konkrete“ Wesen alles Nordens, wo das Wasser reichlich fließt, gegenübertritt: die Verschiedenheit aller Umgebung, die Lebendigkeit der Natur in Wald und Feld, die dampfende Scholle. Lassen sich hier nicht Zusammenhänge denken zwischen dem abstrakt-verstandeshaften Wesen der Juden und dem anschauend verträumten Sinn des nordischen Menschen? Ist es ein Zufall, daß Astronomie und Zählkunst in den heißen Landern mit den ewig klaren Nächten entstanden sind und — wie wir hinzufügen wollen von Völkern ausgebildet wurden, die als Hirtenvölker das Zählen gelernt hatten? Könnten wir uns jene Sumerer, denen man die Erfindung der Keilschrift zuschreibt, und die jenes kunstvolle System der sog. Sexagesimalrechnung in virtuosester Weise handhabten (604), als ein nordisches Volk denken, wie jetzt die germanomanen Rassentheoretiker uns weismachen wollen? Wie sollte so leicht in einer nebligen nordischen Landschaft dem Bauern hinter dem Pflug oder dem Jäger im Walde die abstrakte Vorstellung der Zahl in seinem Geiste aufsteigen?
Auch dieses wird sich nicht wohl bezweifeln lassen, daß das rationale Denken nach Gründen ebenso in die südliche Welt mit ihrer künstlich-gebildeten, nicht gewordenen Natur, in die ewige Unsicherheit des Beduinenlebens hineinführt, wie das, sei es traditionalistische, sei es instinktive Dasein sich in unserer Vorstellung mit dem behäbigen, sicheren, umfriedeten Leben des nordischen Ackerbauers und mit der nebelhaft-mystischen Naturumgebung des Nordmenschen verbindet. Daß der Sinn für das Lebendige, Organische, Gewachsene nur aus der tausendfaltig lebendigen Natur des Nordens sich entwickeln kann oder leichter sich entwickeln wird als aus der toten Natur des Orients, scheint auch nicht allzu unwahrscheinlich. Wie denn ebenso wie die Wüste (der Süden) die Stadt, weil sie den Menschen von der dampfenden Scholle abdrängt und ihn loslöst von dem Zusammenleben mit den Tieren und Pflanzen — organisch-gewachsenen Gebilden —, in ihm das eigne Miterleben des Lebendigen, das allein das „Verständnis“ für die organische Natur vermittelt, verkümmert und zerstört. Wie sie dann aber auf der andern Seite, ebenso wie das Nomadenleben in seiner wüstenhaften Form, die Fähigkeiten des Verstandes entwickelt, der als Späher, als Spionierer, als Zurechtweiser, als Ordner in ewig starker Bewegung erhalten wird. Fortwährend bedacht sein, heischt die Erfüllung seiner Lebensaufgabe vom „Nomaden“ fortwährend bedacht sein, forderte das Schicksal den Juden ab. Also auch zweckbedacht sein: in jedem Augenblicke eine neue Sachlage überblicken, einer neuen Sachlage gerecht werden, sein Leben „weckmäßig einrichten.
Anpassungsfähig und beweglich sind die Juden, Anpassungsfähigkeit und Beweglichkeit sind aber die beiden Haupteigenschaften, über die der „Nomade“ verfügen muß, wenn er im Daseinskampfe obsiegen will, während der seßhafte Bauer mit diesen Tugenden nichts anzufangen wüßte.
„Das Lebensgesetz der Wüste schreibt den Nomaden die höchste Beweglichkeit der Person und des Besitzes vor. Pferd und Kamel müssen ihn und seine gesamte Habe rasch von Weideplatz zu Weideplatz tragen, da seine geringen Vorräten bald erschöpft sind und müssen ihn blitzschnell dem Überfall des stärkeren Feindes entziehen……Diese Beweglichkeit verlangt auch schon unter gewöhnlichen Umständen von den Führern der Stammabteilungen und ganzer Stämme ein gewisses Organisationstalent (605) (dessen der Ackerbauer gar nicht benötigt).
„Der Pflug und der Stier stehen schwach und schwerfällig der Lanze, dem Pfeile und dem Pferde der Nomaden gegenüber (606).“
Das Land der Stadt, kann man erweiternd hinzufügen, wenn man das Lebensschicksal der Juden verfolgt, das von dem Augenblick an, da sie den Jordan überschritten, bis heute von ihnen jenen hohen Grad von Beweglichkeit erheischte.
Sind nicht auch die beiden Gegensätze der Zielstrebigkeit und Werkfreudigkeit auf die Gegensätze von Nomadismus und Siedlertum zurückzuführen: Und die Jahrtausende langen Wanderungen haben dann bei den Juden diese Zielstrebigkeit, die eine echte Wandertugend ist, weiter entwickelt? Von der Wanderung in der Wüste an bis auf unsere Tage hat das gelobte Land stets vor ihnen gelegen: ihm sind sie zugestrebt wie jeder Wanderer sehnsüchtig in die Ferne, in die Zukunft schauend: wie jeder Wanderer wenigstens, dem die Wanderung selbst keine Freuden bringt. Je ärmer die Gegenwart wurde, desto mehr an Reizen gewann die Zukunft, an Bedeutung; alles Seiende wurde schal, alle Wirklichkeit inhaltlos, alles Tun sinnlos; nur was hinter dem Tun in der Zukunft lag, hatte noch Wert: der Erfolg; das zu erreichende Ziel.
(Bei welcher Entstehungsgeschichte der Erfolgsbewertung dann freilich der Gebrauch des Geldes zu Leibzwecken und der gesamte kapitalistische Nexus, wie wir schon sahen, wesentliche Unterstützung und Förderung brachten: sodaß vielleicht die ausgesprochene Zielstrebigkeit der Juden ebenso sehr Wirkung wie Ursache ihrer Betätigung als kapitalistische Wirtschaftssubjekte ist.)
Zur Zielstrebigkeit und ebenso zur Rastlosigkeit, die nur eine andere Form der Betätigung jener Eigenart ist, gehört aber, wie wir feststellen konnten, ein hohes Maß von Körperlicher und geistiger Energie, Sie muß natürlich in den Urrassen gesteckt haben, aus denen die Juden hervorgegangen sind. Und ist dann entfaltet worden — das läßt sich mit ziemlicher Sicherheit aussagen — durch die schicksalschwere Verirrung der Juden in die nordischen Länder. Denn daß der Jude erst in diesen seine volle Kraft (wie auch erst im Zusammenwirken mit den nördlichen, nasskalten Völkern seine ganzen Fahigkeiten) entfaltet, lehrt ein Vergleich zwischen der Wirksamkeit der Juden auf den verschiedenen Breitegraden. Als Besitztum des Volkes ist dann auch diese, im Kampfe um das Dasein, besonders fördersame Veranlagung natürlich vermehrt worden durch die Auslese der „Passenden“
Und wie das Wesen, so hat auch — was im Grunde selbstverständlich ist — die Wesensbetätigung, hat das Wesenswirken dieser beiden verschiedenen Menschheitsgruppen grundverschiedenes Gepräge durch die Verschiedenheiten der Lebensbedingungen erfahren. Wasser und Wald und dampfende Scholle haben ihre Märchen, ihre Sagen, ihre Lieder; haben ihre Ordnungen ebenso eigenartig aus sich erzeugt, wie Wüste und Oase die ihren, Ich weiß nicht, ob schon eine Doktor-Dissertation vorhanden ist, die das Thema behandelt: Goethe und das Wasser: wenn nicht, so wäre es eine dankenswerte Aufgabe darüber eingehend zu berichten. Es würde sich zeigen, daß die echtesten Töne in den Goetheschen Dichtungen dem eigenartigen Zauber entsprungen sind, den die Dunst- und Nebelstimmung im deutschen Walde übt.
- „Füllest wieder Busch und Tall Still mit Nebelglanz“……..
- „Gabst mir die herrliche Natur“……..
- „Durch die Steine, durch die Rasen Eilet Bach und Bächlein nieder“…….
- „Im Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen“.
Und tausend andere Stellen — alle Brockenlieder, alle Sturmgesänge — zeugen dafür.
- „Schweben uns (durch die Jahrtausende).
- Von Felsenwänden, aus dem feuchten Busch,
- Der Vorwelt silberne Gestalten auf:
dann sind wir eine eigenartige Menschheitsgruppe geworden, die sich von denen unterscheidet, deren Väter von heißen Wüstenwinden umweht waren. Aber ich darf diese Gedankengänge, so reizvoll es wäre, nicht in ihre Verzweigungen verfolgen, da mir ja nur die nüchterne Aufgabe obliegt, zwischen jenen besonderen Umwelten und dem Wirtschaftsleben einige Zusammenhänge aufzudecken.
Gewiß ist aber auch, daß gerade die verschiedene Gestaltung des Wirtschaftslebens sich zu einem guten Teile wenigstens aus dem Gegensatz von Nomadismus und Agrikulturismus, von Saharismus und Silvanismus erklären läßt.
Aus dem Walde, den man rodet, aus dem Sumpfe, den man zur Scholle umwandelt, aus der Scholle, auf der der Pflug geht, ist die eigenartige Wirtschaftsverfassung erwachsen, die in Europa Jahrtausende lang geherrscht hat, ehe der Kapitalismus kam: die wir die bäuerlich- oder feudal-handwerksmäßige genannt haben, die auf den Grundgedanken der Nahrung, der Werkverrichtung, der ständischen Gliederung aufgebaut ist. Das abgegrenzte Besitztum des Bauern erzeugt erst die Vorstellung eines abgegrenzten Wirkungskreises, in den das einzelne Wirtschaftssubjekt für alle Zeiten eingeschlossen ist, in dem es sich zu allen Zeiten gleich (traditionalistisch) betätigt: von hier aus dringt die Idee der Nahrung in alle anderen Wirtschaftszweige ein und formt sie nach ihrem Bilde. Über diesen nahrungsmäßig gegliederten, tatsächlich und dann rechtlich gebundenen Wirtschaftseinheiten baut sich dann nur organisch der Ständestaat auf.
Aus der unendlichen Wüste, aus der Herdenwirtschaft erwächst das Widerspiel der alten bodenständigen Wirtschaftsordnung: der Kapitalismus. Das Wirtschaften hat hier keinen umfriedeten Bezirk, keinen abgegrenzten Tätigkeitskreis mehr, sondern das unbeschränkte Feld der Viehzüuchtung, deren Ertrag von heute auf morgen vereitelt sein, aber auch in wenigen Jahren verzehnfacht sein kann: die Herden der Rentiere, Rinder, Pferde, Schafe wachsen rasch und nehmen ebenso rasch durch Seuchen oder Hunger wieder ab. Hier allein in der Herden wirtschaft — niemals in der Sphäre des Ackerbaues — konnte die Erwerbsidee Wurzel schlagen. Hier allein konnte die Wirtschaft auf eine unbegrenzte Vermehrung der Produktenmenge eingestellt werden: „nur die starke Vermehrung der Herden macht den Nomadismus wirtschaftlich möglich“ (Ratzel). Hier allein konnte die Vorstellung entstehen, daß die abstrakte Güterquantität und nicht die Gebrauchsqualität die beherrschende Kategorie des Wirtschaftslebens sei. Hier wurde zum ersten Male beim Wirtschaften gezählt. Aber auch, wie schon angedeutet wurde, dringen die rationalen Elemente in das Wirtschaftsleben durch den Nomadismus ein, der somit in fast allen Punkten der Vater des Kapitalismus ist. Und wir sehen abermals um einige Lichtstärken besser, wie sich das Band zwischen Kapitalismus und Judaismus knüpft, der hier als das Bindeglied zwischen jenem und seinem Urbilde, dem Nomadismus, erscheint.
Aber Wüste und Wanderung, so sehr sie die jüdische Eigenart bestimmt haben, sind doch nicht die einzigen Schicksalsfügungen, denen die Juden ihr Wesen verdanken. Andere sind zu jenen hinzugekommen, keine aber die Wirkungen jener durchkreuzend oder abschwachend, alle vielmehr sie verstärkend und verschärfend.
Das eine große Schicksal, das den Juden noch zu tragen oblag, war das Geld: daß sie die Hüter des Hortes durch Jahrtausende waren, das hat tiefe Spuren in ihr Wesen eingeprägt und hat dieses Wesen in seiner Eigenart gesteigert. Denn in dem Gelde vereinigten sich gleichsam die beiden Faktoren, aus denen sich das jüdische Wesen zusammensetzt, wie wir sehen: Wüste und Wanderung, Saharismus und Nomadismus. Das Geld ist ebenso aller Konkretheit bar wie das Land, aus dem die Juden kamen; es ist nur Masse, nur Menge, wie die Herde, es ist flüchtig wie das Wanderleben; es wurzelt nirgends in fruchtbarem Erdreich wie die Pflanze oder der Baum. Die fortgesetzte Beschäftigung mit dem Gelde drängte die Juden immer wieder und immer mehr von einer natural-ualitativen Betrachtung der Welt ab und lenkte alle Sinne auf die abstrakten quantitativen Auffassungen und Bewertungen hin. Aber sie erschlossen auch alle Geheimnisse, die im Gelde verborgen lagen; sie erkannten alle Wunderkräfte, die in ihm enthalten sind. Sie wurden Herren des Geldes und durch das Geld, das sie sich untertan machten, die Herren der Welt — wie ich das in den ersten Kapiteln dieses Buches eingehend geschildert habe.
Haben sie das Geld zuerst gesucht oder ist es ihnen aufgedrängt worden und haben sie sich dann erst allmählich an diesen fremden Gast gewöhnt? Man wird beide Entstehungsarten für die Geldliebe der Juden gelten lassen müssen.
Es scheint fast, als sei ihnen in den Anfängen ohne ihr Zutun viel Geld zugeflossen; oder richtiger: Edelmetall zugeflossen, das sich dann später in Metallgeld umgewandelt hat.
Man hat, soviel ich sehe, noch niemals darauf geachtet welche großen Mengen von Edelmetall — damals vorwiegend nicht in der Gefdform natürlich — zur Königszeit in Palästina, müssen aufgehäuft gewesen sein.
Von David erfahren wir, daß er auf seinen Beutezügen überall Gold und Silber die Menge einheimste und ebenso, daß ihm die fremden Fürsten Edelmetall als Tribut darbrachten: Joram, der Sohn des Königs von Hemath,
„hatte mit sich silberne und kupferne Geräte, Auch diese weihete der König David dem Jahve, nebst dem Silber und Golde, welches er geweihet von all den Völkern, die er überwunden: von den Syrern und von den Moabitern und von den Söhnen Ammons und von den Philistern und von den Amalekitern und von der Beute Hadadesers, des Sohnes Rehobs, des Königs von Zoba“ (II. Sam, 8, 10—12).
Was wir von der Verwendung von Gold und Silber bei dem Bau der Stiftshütte und des Tempels, von den Opfern und Geschenken der Fürsten lesen (die wichtigsten Stellen finden sich Ex. c. 25ff. und II. Chron.), grenzt an das Wunderbare und gibt doch allem Anschein nach ein ziemlich getreues Abbild der Wirklichkeit (wenigstens lassen die für jene Zeit auffallend genauen statistischen Angaben darauf schließen). „Und der König machte das Silber und das Gold zu Jerusalem den Steinen gleich“ (II. Chr. 1, 15). Von den Ophirfahrten Konig Salomos weiß man: hier muß ein Kalifornien erschlossen sein ! Und wie Jesaias klagt (über Juda): „voll ist sein Land von Silber und Gold“ (2. 7).
Wo ist dies viele Edelmetall geblieben? Die Gelehrten des Talmud haben sich diese interessante Frage vorgelegt und sind zu dem Ergebnis gekommen, daß es bei Israel geblieben sei. „Das ist was R. Alexandri sagte. Drei kehrten nach ihrer Heimat zurück, und zwar: Jisrael, das Geld Micrajims [siehe Ex. 12, 35; 1. Reg. 14, 25] und die Schrift der Bundestafeln,“ (607). Doch wird sich ein „exakter“ Beweis solcher Wanderung gewiß niemals erbringen lassen, Wichtig bleibt nur die Tatsache, daß doch offenbar ein gewaltiger Vorrat der Geldware im Anfang der jüdischen Geschichte bei Israel sich aufgehäuft hatte, der in privatem Geldvermögen auch wieder aufzutauchen geneigt sein mußte. Wozu dann nun im Laufe der Jahrhunderte die von allerwärts her zusammengebrachten Geldvorräte vermehrend hinzutraten.
Denn später strömten große Massen Bargeld in das Land, sei es in Gestalt der Tempelsteuer, sei es in Gestalt des Reisegeldes, das die großen Mengen von Pilgern, die jährlich nach Jerusalem kamen, dort ließen.
Cicero (pro Flacco c. 28) klagt über das Gold, das jährlich aus Italien und allen Provinzen nach Jerusalem geht. In der Tat müssen die auf beide Arten dorthin zusammengeströmten Geldmassen sehr beträchtlich gewesen sein.
Von Mithridates wird uns erzählt, daß er 800 Talente von der Tempelsteuer wegnehmen ließ, die auf der Insel Kos deponiert waren; Cicero berichtet, daß der räuberische Flaccus in vier Städten des westlichen Kleinasien, Apames, Laodices, Pergamum und Adramyttium die jüdischen Stempelsteuern (die auf dem Wege nach Jerusalem waren) an sich riß, und daß die in Apamea erbeutete 100 Pfund Goldes betragen habe. Gewaltig groß aber müssen auch die Massen von Menschen gewesen sein, die jährlich zum Tempel beten kamen. Wenn es auch nicht gerade 2 700 000 waren, wie Josephus meint, und wenn auch die Zahl der Synagogen für die auswärtigen Juden in Jerusalem nicht ganz 380 betragen haben mag, wie derselbe Gewährsmann berichtet. Jedenfalls war hier ein mächtiger Geldkonflux, der recht wohl dazu beigetragen haben kann, daß zahlreiche Leute reich und dadurch befähigt wurden, Geld auf Zinsen auszuleihen. Vielleicht in erster Linie die Priester, von denen wir wissen, daß sie reich dotiert und Leibgeschäften nicht abgeneigt waren (608).
Haben die Juden die Geheimnisse des Geldes selbst erschlossen? Haben sie die Technik des Leihverkehrs aus sich heraus entwickelt oder haben sie sie von den Babyloniern gelernt: Daß hier in Babylon in vorjüdischer Zeit ein reger Geldverkehr bestanden hat, scheint jetzt fast erwiesen, obwohl wir über seine Art und Gestalt wenig Zuverlässiges wissen. Das, was die bisher übersetzten Quellenstellen erkennen lassen, gibt gar keinen sicheren Anhalt, um festzustellen: wie hoch die Entwicklung des Geld- und Geldleibgeschäfts gediehen war. Immerhin mögen die Keime der jüdischen Geldkunst hier bei ihren Vettern von Babylon liegen. Die Frage, ob dieser oder jener Stamm jener Völker, die ja doch alle aus gleicher Wurzel getrieben sind, die ersten goldenen Früchte getragen habe, ist im Grunde ziemlich nebensächlich. Bedeutsamer — und in seinen Wirkungen durchaus klar — ist der Umstand, daß das spätere Schicksal den Juden die Geldliebe aufnötigte und die Geldkunst anzüchten mußte.
Ihre Landflüchtigkeit zwang sie ja — seit ihrem Auszug aus Ägypten —, ihrem Hab und Gut immer beweglichere Formen zu geben, und unter diesen bot sich das Geld — neben Schmucksachen — als die geeignetste dar. Es wurde ihr einziger Begleiter, wenn sie nackt auf die Straße geworfen wurden; und ihr einziger Beschützer, wenn man sie quälte und mißhandelte: sollten sie es nicht lieben lernen, wenn sie mit seiner Hilfe die Großen dieser Erde sich unterwürfig machen konnten: Das Geld wurde ihnen — und durch sie der ganzen Menschheit — zum Mittel Macht zu üben, ohne selbst stark zu sein: mit den feinen Füden des Geldleihgeschafts fesselte ein Volk von kleinen, in sozialem Sinne ganz unscheinbaren Menschen den feudal-bäuerlichen Riesen: wie die Liliputaner den Gulliver banden.
Mit diesen letzten Gedanken habe ich aber abermals an ein Schicksal der Juden erinnert, das von vielen als ganz besonders bedeutsam für die Ausbildung ihres Wesens angesehen wird und das sicher auch nicht ohne eigenartige Wirkung geblieben ist: ihr Ghettoschicksal.
Daß dieses die gesellschaftliche Stellung der Juden ganz eigenartig beeinflußt hat, daß es aus ihnen eine verachtete Pariakaste gemacht hat, ist einleuchtend. Der größte Teil der Ghettojuden gehörte den sozial niederen Schichten an und wurde selbst von seinen Glaubensgenossen als etwas Minderwertiges empfunden. Der Gegensatz zwischen Ghettojuden und freien Juden kam ja einst in dem Gegensatz zwischen Aschkenazim und Sephardim zum sehr greifbaren Ausdruck. Die beiden standen sich wie feindliche Brüder gegenüber, das heißt genauer: die Sephardim sahen auf die aschkenazischen Juden mit Verachtung herab und empfanden sie wie lästige bettelhafte Aufdringlinge.
So schrieb ein deutscher Jude in bitterem Spotte an seinen sephardischen Glaubensgenossen um die Mitte des 18. Jahrhunderts (als der Gegensatz seine stärkste Spannung erhalten hatte) wie folgt: (609)
„Je scai, Monsieur, que les Juifs Portugais n’ont de commune avec les Juifs Allemans qu’une operation religieuse et que l’éducation et les mæurs ne laissent entr‘ eux aucune ressemblance réelle quant à la vie civile. Je scai Jue l’affinité entre les uns et les autres est d’une Tradition extrement reculée et que le Gaulois Vercingentorix et l’Allemand Arminius ètoient plus proches parens du beau-Pére d’Herode que vous du Fils d’Ephraim.“
Ganz ähnlich ließ sich der Sepharde Pinto aus in seiner bekannten Antwort auf die Angriffe, die Voltaire „gegen die Jude“ schlechthin erhoben hatte. (610) Pinto legt entscheidenden Wert darauf, daß die Spaniolen nicht mit den deutschen Juden „in einen Topf geworfen“ werden: sie seien eben zwei verschiedene Nationen.
„Un Juis de Londres ressemble aussi peu à un Juif de Constantinople que celui-ci a un Mandarin de la Chine. Un Juif Portugais de Bordeaux et un Juit Allemand de Metz paroissent deux etres absolument differens.“
„Mr. de Voltaire ne peut ignorer la délicatesse scrupuleuse des Juifs Portugais et Espagnols à ne point se méler, par marriage, alliance ou autrement avec les Juifs des autres Nations.“
Wenn ein sephardischer Jude, meint Pinto, in England oder Holland eine deutsche Jüdin heimführen würde, würde er von den Seinen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden und würde nicht einmal auf ihrem Begräbnisplatz eine Ruhestätte finden.
Die Gegensätzlichkeit kam in dem äußeren Verhalten namentlich der sephardischen Juden, die sich als die Aristokratie innerhalb der Judenschaft fühlten, und die sich durch die andringende Schar der sozial tiefer stehenden Ostlinge in ihrer gesellschaftlichen Stellung bedroht sahen, oft genug zum Ausdruck.
So setzten im Jahre 1761 die portugiesischen Juden (oder Marranen) in Bordeaux einen dringenden Befehl durch: daß sämtliche fremde Juden innerhalb 14 Tagen Bordeaux zu verlassen hätten. Pinto und Pereira waren dabei die treibenden Kräfte; sie boten alles auf, um die „Landstreicher“ – ihre eigenen Glaubensgenossen aus Deutschland und Frankreich sobald als möglich los zu werden. (611)
Wie in Hamburg die sephardischen Juden gleichsam eine Aufsichtsbehörde gegenüber den Aschkenazim bildeten, die dafür zu sorgen hatte, daß diese keine Schmutzereien im Handel und Verkehr verübten, haben wir in einem andern Zusammenhange schon in Erfahrung gebracht.
Das Gefühl der Gegensätzlichkeit, das wie gesagt hauptsächlich von den Sephardim genährt wurde, hatte seine Wurzeln vor allem, wie auch schon angedeutet wurde, in dem Gegensatz der sozialen Stellung. Es wurde aber genährt durch ein stark aristokratisches Bewußtsein, das die Sephardim erfüllte, weil sie sich von edlerer Herkunft als die Aschkenazim wähnten: wollten sie doch sämtlich von den edelsten Familien des Stammes Juda ihre Abstammung ableiten und waren sie doch von dem echten Blutsstolze erfüllt, daß diese edle Abstammung für sie in Spanien und Portugal von jeher ein Antrieb zu großen Tugenden und ein Schutz vor Lastern und Niedrigkeit gewesen sei.
„L’idée, où ils sont assez généralement, d’étre issus de la Tribe de Juda, dont ils tiennent que les principales familles furent envoyées en Espagne du temps de la captivité de Babylone, ne peut que les porter à ces distinctions et contribuer à cette èlèvation de sentimens qu’on remarque en eux.“ (612)
Das gibt zu denken. Und veranlaßt uns vielleicht, die Bedeutung des Getto für die Entwicklung des Judentums richtiger einzuschätzen als bisher. Jene Auffassung der sephardischen Juden von Würde und Haltung als höchste Tugenden weist auf die Möglichkeit hin, daß diese Lebensanschauung, die den Gegensatz gegen alles Aschkenazische deutlich empfand, wohl gar die Ursache war, weshalb die spanisch-portugiesischen Juden kein Ghetto gehabt haben, und nicht die Wirkung dieser Tatsache.
Mit andern Worten: es wird sich kaum bezweifeln lassen, daß ein Teil der Juden nur darum dem Gettoleben anheimfiel, weil es seiner Natur nach dazu neigte.
Ob der Grund, weshalb die Einen im Getto endigten, die andern nicht, in der blutsmäßig verschiedenen Veranlagung der beiden Gruppen gelegen ist; ob (wofür auch vieles spricht.) die sephardischen Juden seit altersher eine soziale Auslese darstellten, läßt sich, wie schon einmal gesagt wurde, mit den jetzigen Hilfsmitteln nicht entscheiden. Daß hier aber verschiedene Veranlagung das verschiedene Schicksal mindestens befördert habe, dürfen wir als sehr wahrscheinlich annehmen.
Nur soll man wiederum diese Verschiedenheit der Veranlagung nicht zu hoch einschätzen; das spezifisch jüdische Wesen wird durch sie doch nicht in seiner Eigenart berührt. Die letzthin entscheidenden Züge der jüdischen Psyche sind hier wie dort dieselben. Nur insofern ist hier also das Gettoleben von Bedeutung geworden, als einmal in seinem Dunstkreis eine Menge von Gewohnheiten, von Praktiken sich ausbildeten, die den Ghettojuden dann in seiner weiteren wirtschaftlichen Laufbahn begleiteten und sein geschäftliches Leben oft in eigenartiger Weise beeinflußten, Es sind zum Teil die Gewohnheiten der sozial niedrig Stehenden überhaupt, die aber natürlich im jüdischen Blute ein ganz merkwürdiges Gepräge annehmen: Neigung zu kleinen Betrügereien, Aufdringlichkeit, Würdelosigkeit, Taktlosigkeit usw. Sie haben sicher eine Rolle gespielt, als die Juden daran gingen, die Feste der alten handwerksmäßig feudalen Wirtschaftsordnung zu erobern: in dem Kapitel, das vom Aufkommen einer modernen Wirtschaftsgesinnung handelt, haben wir öfters die Wirkungen gerade dieser Charakterzüge feststellen können.
Nur soll man eben die Bedeutung dieser mehr äußerlichen Züge nicht übertreiben. Sie mögen für die gesellschaftliche Stellung der Juden uns persönlich sehr bedeutsam erscheinen: für ihre wirtschaftlichen Erfolge sind sie doch nur von geringer Wichtigkeit. Mit ihnen allein wären die Juden sicher nicht zu ihrer weltbeherrschenden Stellung gelangt.
Viel wichtiger erscheint mir eine andere Wirkung des Ghetto: daß es nämlich die wirklichen Grundzüge des jüdischen Wesens stärker und einseitiger hat ausbilden helfen. Wenn dieses, wie wir sahen, letzten Endes in dem Mangel an Bodenständigkeit und Wurzelhaftigkeit sein Gepräge findet, so ist es einleuchtend, daß ein paar Jahrhunderte Gettoleben diesen Mangel vergrößern mußten. Aber auch hier ist nur deutlicher herausgekommen, was längst im Wesen, im Blute geruht hatte.
Dieselbe Wirkung: nämlich die Eigenart des jüdischen Wesens zu bekräftigen, hat dann das Gettoleben auf Umwegen noch dadurch ausgeübt, daß es die beiden Mächte gestärkt hat, auf denen zum guten Teile die zähe Konstanz des jüdischen Wesens beruht, die beide die Funktion gehabt haben: die durch Auslese herausgebrachten Charaktere weiter einseitig zu beeinflussen und fest zu erhalten: die Religion und die Inzucht.
Daß die Religion eines Volkes selber aus dessen Wesen entspringt, wurde oben als die Auffassung ausgesprochen, die diesen ganzen Ausführungen zugrunde liegt. Aber darum bleibt es doch wahr, daß eine exklusiv-formalistische Religion, wie die jüdische, eine ganz gewaltige Wirkung ausüben kann auf die Wesenheit ihrer Anhänger, insbesondere auf die Vereinheitlichung und Schematisierung der Lebensführung. In welcher weitgehenden Weise die jüdische Religion diese Wirkung ausgeübt hat, ist seinerzeit ausführlich dargelegt worden: man erinnere sich nur ihrer rationalisierenden Tendenz, die wir als ihren Grundzug kennen lernten,
In gleicher Richtung aber: Art erhaltend, Art verstärkend wirkte, ich möchte sagen, die physiologische Seite der jüdischen Nationalreligion — denn mit dieser steht sie in engstem Zusammenhange —, die Inzucht, die, wie wir sahen, die Juden seit mehreren tausend Jahren geübt haben.
Die Inzucht, sage ich, steht mit der Religion bei den Juden in engem Zusammenhange; man wird noch mehr sagen dürfen: sie ist eine unmittelbare Folge der tragenden Idee dieser Religion: der Auserwählungsidee. Das ist in einer Reihe von Untersuchungen in letzter Zeit mit feinem Verständnis nachgewiesen worden, insbesondere von Alfred Nossig, der sich darüber wie folgt vernehmen läßt es
„Als ein frappantes biologisches Ergebnis dieser (Auserwählungs-) Idee tritt uns die Tatsache des Bestehens und der noch immer ungewöhnlichen Lebens- und Reproduktionskraft der Juden entgegen. Der mosaische Gedanke eines ewigen Volkes, scheint sich verwirklichen zu wollen.“
Speise und Ehegesetze sorgen für gute Erhaltung.
„Selbstverständlich war es dann, daß diese höchsten ethischen Schätze nicht der Vernichtung auf dem Wege der Vermischung miteinander sorgfältig gezüchteter Rassen preisgegeben wurden. Das Verbot der Mischehen bewirkte es, daß der erste rebildende Faktor, die Vererbung, seine Wirkungskraft in höchster Potenz betätigen konnte, indem die angedeuteten Vorzüge nicht nur unvermindert von Generation auf Generation übergingen, sondern dank der Inzucht sich stetig steigerten“.
„Die Inaucht hat also bewirkt, daß durch die ungemein oft fortgesetzte Vererbung der jüdischen Rassenmerkmale sich diese den Nachkommen immer fester aufgeprägt haben, immer intensiver an ihnen hafteten, sodaß es immer schwerer wurde, sie durch Blutmischung zu beseitigen oder wesentlich zu verändern. Denn es ist nachgewiesen, daß, wie jede andere Funktion das Lebendige durch Übung verstärkt, so auch die Vererbungsintensität durch fortgesetzte Inzucht zunimmt (614)“
Religion und Inzucht waren die beiden eisernen Reifen, die das jüdische Volk fest umschlossen und als eine einzige feste Masse durch die Jahrttausende erhalten haben. Und wenn sie sich lockern? Was wird dann die Wirkung sein: Auf diese inhaltschwere Frage zu antworten, war hier nicht als Aufgabe gestellt. Denn so lange wir die Juden die eigentümliche Wirkung im Wirtschaftsleben ausüben sahen — also bis heute hielten die Reifen fest. Und nur jene Wirkung galt es ja zu erklären und wiederum nur die Genesis des jüdischen Wesens galt es zu schildern, aus dessen Eigenart heraus wir jene wundersame Einwirkung der Juden auf das Wirtschaftsleben und die gesamte Kultur zu deuten unternommen hatten.
Impressum